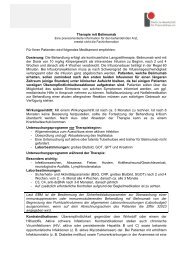Zeitschrift für Rheumatologie – Supplement 1 - Deutsche ...
Zeitschrift für Rheumatologie – Supplement 1 - Deutsche ...
Zeitschrift für Rheumatologie – Supplement 1 - Deutsche ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
S60<br />
Abstracts<br />
POFR4 Posterpräsentation: Vaskulitiden,<br />
Kasuistiken, Osteologie<br />
POFR4-1<br />
EULAR/EUVAS Empfehlungen zur Durchführung klinischer und/oder<br />
therapeutischer Studien bei systemischen Vaskulitiden<br />
Hellmich B. 1 , Flossmann O. 2 , Gross WL. 3 , Luqmani R. 1 , on behalf of the<br />
EULAR vasculitis study group. 4<br />
1 Poliklinik <strong>für</strong> <strong>Rheumatologie</strong>, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein,<br />
Campus Lübeck, 2 Department of Nephrology, University of Cambridge,<br />
Cambridge, UK, 3 Department of Rheumatology, Nuffi eld Orthopaedic<br />
Centre, Oxford, UK, 4 EULAR/EUVAS<br />
Hintergrund: Die Ergebnisse therapeutischer Studien bei systemischen<br />
Vaskulitiden waren in der Vergangenheit oft nur mit Einschränkungen<br />
vergleichbar, da sich das Studiendesign, Krankheitsdefi nitionen und<br />
Outcomeparameter häufi g in wesentlichen Punkten unterschieden.<br />
Ziel: des Projekts war die Entwicklung von Empfehlungen zur Durchführung<br />
klinischer Studien bei systemischen Vaskulitiden.<br />
Methoden: Unter Schirmherrschaft der Europäischen Rheumaliga<br />
(EULAR) und der europäischen Vaskulitisstudiengruppe (EUVAS)<br />
wurde eine Expertengruppe bestehend aus Rheumatologen, Nephrologen,<br />
Internisten, einem klinischen Epidemiologen und Vertreten<br />
der Gesundheitsbehörden aus 5 europäischen Ländern und den USA<br />
gebildet. Unter Anwendung der EULAR-Empfehlungen zur Leitlinienentwicklung<br />
wurden 15 Th emen <strong>für</strong> eine systematische Literatursuche<br />
über eine modifi zierte Delphi-Technik identifi ziert. Basierend auf<br />
den Ergebnissen der systematischen Literaturanalyse wurden von der<br />
Gruppe unter Einbeziehung der Expertenmeinung Empfehlungen zur<br />
Durchführung klinischer und/oder therapeutischer Studien bei systemischen<br />
Vaskulitiden entwickelt.<br />
Ergebnisse: Die systematische Literatursuche ergab, dass nur <strong>für</strong> die mit<br />
antineutrophilen zytoplasmatischen Antkörpern (ANCA) assoziierten<br />
Vaskulitiden ein ausreichender Grad der Evidenz vorlag, der die Formulierung<br />
von validen Empfehlungen zulässt. Es wurde daher entschieden<br />
die Empfehlungen auf ANCA-assoziierte Vaskulitiden zu fokussieren<br />
und Vaskulitis-spezifi sche Aspekte in den Vordergrund zu stellen. Die<br />
Empfehlungen nehmen zu den folgenden Aspekten klinischer Studien<br />
bei systemischen Vaskulitiden Stellung: Defi nition der Krankheitsbilder,<br />
Defi nition von Krankheits- und Aktivitätssstadien, Erfassung<br />
und Messung des Outcomes, Ein- und Ausschlusskriterien, Studiendesign<br />
einschliesslich einer Defi nition relevanter Endpunkte und die Anwendung<br />
von Biomarkern. Als Stadien der Krankheitsaktivität wurden<br />
die Begriff e „Remission“, „Ansprechen“, „refraktäre Erkrankung“, „geringe<br />
Krankheitsaktivität“ und „Rezidiv“ defi niert. Th emengebiete mit<br />
noch geringer Evidenz wurden in einem Forschungsplan als Ziele <strong>für</strong><br />
zukünft ige Untersuchungen zusammengefasst.<br />
Schlussfolgerungen: Basierend auf einer systematischen Literaturanalyse<br />
und Expertenmeinung wurden Empfehlungen zur Durchführung<br />
von klinischen Studien bei ANCA-assoziierten Vaskulitiden entwickelt.<br />
Darüberhinaus identifzierte das Expertengremium einen dringenden<br />
Bedarf an methodisch gut geplanten klinischen Studien bei<br />
nicht-ANCA-assoziierten systemischen Vaskulitiden.<br />
POFR4-2<br />
Rolle des Makrophagen migrationsinhibierenden Faktors in der<br />
Pathogenese der Sklerodermie<br />
Becker H., Maaser C., Willeke P., Schotte H., Domschke W., Gaubitz M.<br />
Medizinische Klinik und Poliklinik B, Universitätsklinikum Münster<br />
Zielsetzung: Einer gesteigerten Zytokinsekretion wird <strong>für</strong> die Entwicklung<br />
der Fibrose und der Gefäßveränderungen bei der Sklerodermie<br />
eine wesentliche Rolle zugeschrieben. In Hautbiopsien fi ndet sich eine<br />
vermehrte Expression des Makrophagen migrationsinhibierenden<br />
| <strong>Zeitschrift</strong> <strong>für</strong> <strong>Rheumatologie</strong> · <strong>Supplement</strong> 1 · 2006<br />
Faktors (MIF) [1]. MIF wird von Makrophagen, T-Lymphozyten, aktivierten<br />
Endothelien sowie Fibroblasten produziert und amplifi ziert<br />
Entzündungsmechanismen über eine Induktion proinfl ammatorischer<br />
Zytokine, wie z.B. Tumornekrosefaktor-alpha und Interleukin-6. Ziel<br />
unserer Untersuchungen war es, zu klären, welche Bedeutung MIF <strong>für</strong><br />
den systemischen Entzündungsprozess bei der Sklerodermie hat.<br />
Methoden: MIF wurde im Serum von 33 Patienten mit progressiver<br />
systemischer Sklerodermie und 33 alters- und geschlechtsentsprechenden<br />
gesunden Kontrollpersonen mit einem Enzymimmunoassay<br />
wie früher beschrieben [2] bestimmt. Korrelationen zum klinischen<br />
Verlauf, zur Th erapie und zu Laborbefunden wurden untersucht. Zur<br />
statistischen Auswertung wurden nichtparametrische Tests eingesetzt.<br />
Ergebnisse: Bei den untersuchten Patienten fanden sich erhöhte MIF-<br />
Spiegel (Median 27 ng/ml, Bereich 0,014-99,4) verglichen mit Kontrollen<br />
(9,7 ng/ml, 0,014-36,5; Mann-Whitney-U-Test, p=0,007). In<br />
der Untergruppe der Patienten mit CREST-Syndrom (n=9) wurden<br />
niedrige MIF-Werte gemessen, bei den übrigen Patienten zeigten sich<br />
bei positiven anti-Scl-70 (Topoisomerase I)-Antikörpern (Ak; n=16)<br />
tendenziell höhere MIF-Spiegel als bei negativen anti-Scl-70-Ak (n=8).<br />
Die MIF-Werte korrelierten mit den Spiegeln des C-reaktiven Proteins<br />
(n=33; Spearman-Rang-Test, p=0,02). Zusammenhänge mit der<br />
Krankheitsdauer, dem Vorliegen bestimmter Organmanifestationen<br />
oder mit der Th erapie wurden nicht beobachtet.<br />
Schlussfolgerungen: MIF wird bei der progressiven systemischen<br />
Sklero dermie im Rahmen der Akutphase-Reaktion vermehrt freigesetzt.<br />
MIF könnte insbesondere bei der entzündlich aktiven, anti-Scl-<br />
70-Ak assoziierten Erkrankung zur Induktion proinfl ammatorischer<br />
Zytokine und zur Schädigung der Endothelien in verschiedenen Organen<br />
beitragen.<br />
Literatur:<br />
1. Selvi E et al. Expression of macrophage migration inhibitory factor in<br />
diff use systemic sclerosis. Ann Rheum Dis 2003; 62: 460-4<br />
2. Maaser C et al. Ubiquitous production of macrophage migration inhibitory<br />
factor by human gastric and intestinal epithelium. Gastroenterology<br />
2002, 122: 667-80<br />
OFR4-3<br />
Die Ösophagusmanometrie als Erfolgskontrolle immunsuppressiver<br />
Therapie bei systemischer Sklerodermie<br />
Hartleb J., Gregor S., Götz M., Galle P R., Schwarting A.<br />
1. Medizinische Klinik, Johannes Gutenberg-Universität Mainz<br />
Die systemische Sklerodermie ist eine seltene, chronisch-entzündliche<br />
Erkrankung, bei der es zu einer Fibrosierung der Haut, der Gefäße und<br />
innerer Organe kommt.<br />
Die Ösophagusbeteiligung, als eine der häufi gsten extrakutanen Manifestationen,<br />
wird mit Hilfe der Ösophagographie und der Manometrie<br />
diagnostiziert.<br />
Ziel dieser Studie ist es, zu beurteilen, ob die Ösophagusmanometrie<br />
neben der diagnostischen Anwendung auch als objektives Messverfahren<br />
zur Verlaufsbeurteilung der Ösophagusbeteiligung und zur<br />
Erfolgskontrolle immunsuppressiver Th erapie bei systemischer Sklerodermie<br />
verwendet werden kann.<br />
Um dies zu überprüfen wurden 10 Patienten zu Beginn der Studie<br />
und ein Jahr darauf manometrisch untersucht, um mögliche Veränderungen<br />
zwischen 1. und 2. Messung festzustellen. Von diesen 10 Patienten<br />
wurden 6 im Untersuchungszeitraum immunsuppressiv therapiert,<br />
4 Patienten erhielten eine rein symptomatische Th erapie.<br />
Weiterhin wurde eine Ösophagographie durchgeführt und eine Einschätzung<br />
des Dysphagieschweregrades durch den Patienten erhoben.<br />
Die Ergebnisse zeigten, dass es unter immunsuppressiver Th erapie bei<br />
1 Patientin zu einer deutlichen Verbesserung der Manometriebefunde,<br />
bei 3 Patienten zu einem Gleichbleiben der Werte und bei 2 Patienten<br />
zu einer Verschlechterung kam.