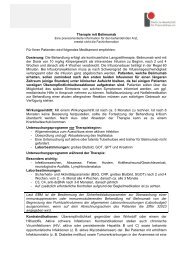Zeitschrift für Rheumatologie – Supplement 1 - Deutsche ...
Zeitschrift für Rheumatologie – Supplement 1 - Deutsche ...
Zeitschrift für Rheumatologie – Supplement 1 - Deutsche ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
oft erst am konkreten Fall festlegt werden. Gerade dieser nachhaltige<br />
Lerneff ekt soll mit der beschriebenen Team-orientierten Aus- und<br />
Weiterbildung mit Diskussion von Fällen in Kleingruppen gezielt gefördert<br />
und herausgearbeitet werden.<br />
Wir haben die Team-orientierten Lehrveranstaltungen mittels eines<br />
Evaluationsbogens von den Teilnehmern bewerten lassen. Auf einer<br />
Skala von 1 (trifft nicht zu) bis 10 (trifft zu) konnten Noten in verschiedenen<br />
Kategorien verteilt werden. Die Kategorien umfassten u. a. Fragen<br />
zur Motivation der Teilnehmer während der Lehrveranstaltung,<br />
zum Lerneff ekt nach der Veranstaltung sowie zur Beurteilung im Vergleich<br />
zu konventionellen Lehrveranstaltungen.<br />
In der vorläufi gen Auswertung der Evaluationsbögen zeigt sich dabei<br />
ein signifi kanter Unterschied zwischen Ärzten und Studenten bezüglich<br />
der Akzeptanz der Team-orientierten Veranstaltung: Studenten<br />
bewerteten diese im Durchschnitt deutlich schlechter als Ärzte. Von<br />
Ärzten wurde die team-basierte Veranstaltung dagegen als deutlich<br />
motivierender und sogar lehreicher als konventionelle Lehrveranstaltungen<br />
beurteilt. Ähnliche Unterschiede zeigen sich auch in den<br />
Bewertungen der anderen Kategorien. Die Gründe <strong>für</strong> das schlechte<br />
Abschneiden des Team-orientierten Lernens bei den Studenten sind<br />
unklar. Angesichts des häufi g von Studenten kritisierten „Frontalunterrichts“<br />
ist das Ergebnis aus unserer Sicht auch überraschend. Möglicherweise<br />
ist aber sind Ärzte durch die ständig in der Praxis betriebene<br />
Diskussion unter Kollegen von diesem Team-orientierten Lernmodell<br />
eher überzeugt als Studenten. Gerade <strong>für</strong> junge Kollegen könnte diese<br />
Form der Lehrveranstaltung daher von Vorteil sein.<br />
PODO4-16<br />
Das chimäre Pfp/Rag2-/- Mausmodell als neues System zum Verständnis<br />
vaskulär entzündlicher Prozesse<br />
Ullrich S. 1 , Schumacher U. 2 , Maixing A. 1 , Gay S. 3 , Kirkiles Smith N. 4 , Pober J. 4 ,<br />
Gross WL. 1 , Csernok E. 4<br />
1 Poliklinik <strong>für</strong> <strong>Rheumatologie</strong>, Universitätsklinikum Lübeck, 2 Anatomie II,<br />
Universitätsklinik Hamburg, 3 Zentrum <strong>für</strong> Experimentelle <strong>Rheumatologie</strong><br />
Zürich, 4 Yale University Medical School<br />
Ziele: Die vorliegende Studie hatte das Ziel ein immundefi zientes<br />
Mausmodell zu entwickeln, in dem ein möglichst breites Spektrum<br />
humaner Leukozytenfraktionen im Kapillarsystem humaner Hauttransplantate<br />
untersucht werden kann. Damit soll die Grundlage <strong>für</strong><br />
ein neuartiges Modell vaskulärer Entzündungsprozesse geschaff en<br />
werden, in dem pathogenetische Aspekte primär systemischer Vaskultitiden<br />
untersucht werden können.<br />
Methoden: 27 Immundefi ziente Pfp/Rag2-/- Mäuse wurden bilateral<br />
mit humaner Spalthaut transplantiert. Am Transplantationstag wurden<br />
den Mäuse 1x108 humane periphere Leukozyten (huPBL) intraperitoneal<br />
appliziert. Nach 20 Tagen erfolgte eine repetitive i.v. Gabe von<br />
1x107 humanen neutrophilen Granulozyten (huPMN). Nach 24 Stunden<br />
erfolgte die Entnahme von Transplantaten, Blut und Organen. Die<br />
Analyse der Zellmigration in Gewebe und Blut nach Rekonstitution<br />
wurde mittels FACS Analyse und immunhistochemie quantifi ziert.<br />
Ergebnisse: In 70% (19/27) der Pfp/Rag2-/- Mäuse fand sich nach 21<br />
Tagen eine deutlich nachweisbare Rekonstitution humaner Zellen in<br />
mauseigenem Gewebe, humaner Haut und mauseigenem Blut. Der<br />
Anteil zirkulierender CD45 positiver humaner Zellen in der mauseigenen<br />
Zirkulation variierte zwischen 1,8<strong>–</strong>8,24% (Im Mittel 5,02%). Dichte<br />
humane Zellinfi ltrate waren regelhaft in Lunge, Leber und Milz der<br />
Mäuse, sowie diff us in den humanen Hauttransplantaten nachweisbar.<br />
Humane Granulozyten traten dabei vornehmlich im Bereich der humanen<br />
Haut auf. Die Subpopulationen CD45 positiver humaner Zellen<br />
bestanden neben Granulozyten vornehmlich aus CD3 positiven T-Zellen,<br />
CD20 positive B-Zellen waren nur spärlich nachweisbar.<br />
Diskussion: Im Gegensatz zu bisher etablierten Mausmodellen humaner<br />
Hämatopoese konnte <strong>für</strong> den hier verwendeten Pfp/Rag2-<br />
/- Mäusestamm erstmalig eine stabile hämatopoetische Rekonstitution<br />
ohne diff erenzierte Vorkonditionierung (Bestrahlung,<br />
NK Zelldepletion) nachgewiesen werden. Die Rekonstitution ist über<br />
den untersuchten Zeitpunkt (maximal 21 Tage) stabil und nicht letal<br />
(Graft versus host Reaktion) und ermöglicht so eine lange Versuchsdauer.<br />
In Kombination des von uns bereits in diesem Mäusestamm<br />
etablierten Transfermodells humaner Haut und huPMN wird somit ein<br />
neuartiges Modell zum Verständnis der pathogenetischen Bedeutung<br />
verschiedener humaner Zellfraktionen in der Entstehung vaskulärer<br />
Entzündungsprozesse vorgestellt. In diesem sind nun weitere Untersuchungen<br />
zur Entstehung systemischer Vaskulitiden (z.B. Funktion von<br />
T-, B-Zellen, PMN und ANCA in der Pathogenese der Wegener´schen<br />
Granulomatose) möglich.<br />
PODO4-17<br />
Quality of Sleep in patients with Systemic Lupus erythematosus<br />
- part of the LuLa-Study 2005 -<br />
Beer S. 1 , Asfour M. 1 , Richter J. 1 , Winkler-Rohlfi ng B. 2 , Schneider M. 1<br />
1 Center of Rheumatology, Heinrich-Heine-University Duesseldorf, Germany,<br />
2 German Lupus Self-Help Community (SHG), Wuppertal, Germany<br />
Background: Adequate sleep is essential for the maintenance of health<br />
and quality of life. However sleep problems are among the most common<br />
complaints in our society. Particularly patients with chronic rheumatic<br />
diseases, as e.g. SLE, report sleep problems.<br />
Methods: Th e LuLa-Study is a longitudinal cross-sectional survey of<br />
the German lupus erythematosus self-help community on course,<br />
therapy, socio-economic and other factors infl uencing the disease and<br />
everyday life of these patients. It was started in 2001 and is intended to<br />
run for 10 years. Data are collected once a year by means of a self-reporting<br />
questionnaire. One objective of the 2005 part of the study was to<br />
analyse sleep and fatigue in the participants. Th e Pittsburgh Sleep Quality<br />
Index (PSQI) is an eff ective and valid instrument for measuring retrospectively<br />
quality and quantity of sleep over a 1-month period using<br />
self-reports. It diff erentiates “poor” from “good” sleep by sampling 18<br />
items allocated to 7 components: subjective sleep quality, sleep latency,<br />
sleep duration, habitual sleep effi ciency, sleep disturbances, use of sleeping<br />
medication and daytime dysfunction. Scoring of answers is based<br />
on a 0-3 scale. A global sum of the component scores is calculated with<br />
a possible total value ranging from 0-21. A higher score corresponds<br />
to decreased quality of sleep. An empirically defi ned cut-off -value of<br />
“5” allows a graduation in “good” and “poor” sleepers. A score >5 indicates<br />
“poor” sleep, whereby a value >10 depicts severe chronic sleep<br />
disturbances.<br />
Results: In 2005 we collected information on sleep of 866 patients<br />
(94.1% female; mean age 48.8 yrs; mean disease duration 11.0 yrs). Effective<br />
sleeping time amounts to 3-12 hours with a mean of 6,8 (SD 1,4)<br />
<strong>–</strong> average sleep effi ciency was 78.8 (range 30<strong>–</strong>100)%. Th e mean PSQI-<br />
Score was 7,35 (SD 3,8) ranging from 0<strong>–</strong>19. 335 (38.7%) of the patients<br />
were “good” sleepers with a low score from 0<strong>–</strong>5. 340 (39.3%) had a score<br />
from 6-10 representing “worsened” sleep and the remaining 191 (22.1%)<br />
reported on “serious deranged” sleep with a score >10. Many of the<br />
patients attribute their poor sleep quality to pain but also other reasons<br />
had been specifi ed as e.g. breathing problems, nycturia, displeasing of<br />
temperature as well as bad dreams.<br />
Conclusion: With 61.3% a signifi cant proportion of a representative<br />
group of German lupus patients reports moderate to severe sleep impairment.<br />
Th ese derogations contribute additionally to the generally<br />
diminished quality of life in SLE patients.<br />
<strong>Zeitschrift</strong> <strong>für</strong> <strong>Rheumatologie</strong> · <strong>Supplement</strong> 1 · 2006 | S53