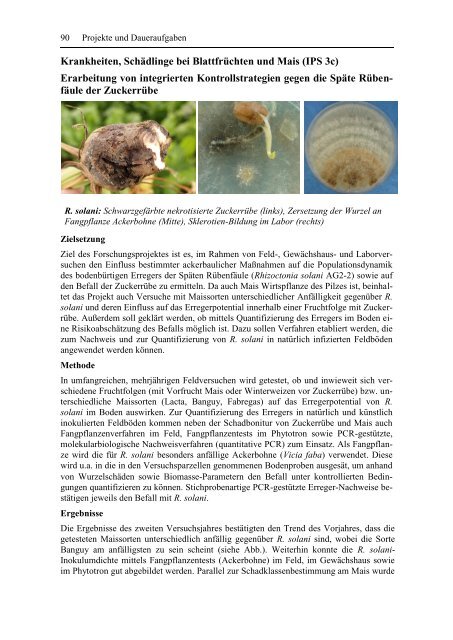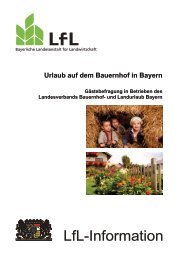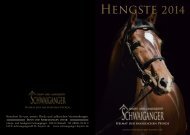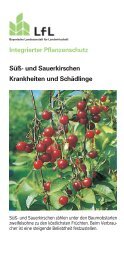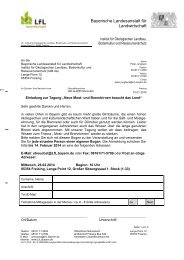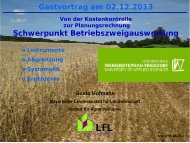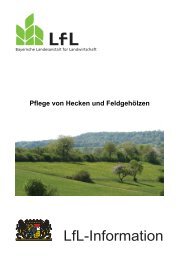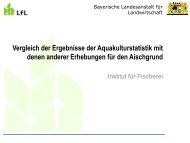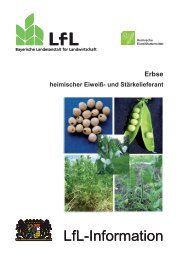Jahresbericht 2011 - Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft ...
Jahresbericht 2011 - Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft ...
Jahresbericht 2011 - Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
90 Projekte und Daueraufgaben<br />
Krankheiten, Schädlinge bei Blattfrüchten und Mais (IPS 3c)<br />
Erarbeitung von integrierten Kontrollstrategien gegen die Späte Rübenfäule<br />
der Zuckerrübe<br />
R. solani: Schwarzgefärbte nekrotisierte Zuckerrübe (links), Zersetzung der Wurzel an<br />
Fangpflanze Ackerbohne (Mitte), Sklerotien-Bildung im Labor (rechts)<br />
Zielsetzung<br />
Ziel des Forschungsprojektes ist es, im Rahmen von Feld-, Gewächshaus- und Laborversuchen<br />
den Einfluss bestimmter ackerbaulicher Maßnahmen auf die Populationsdynamik<br />
des bodenbürtigen Erregers der Späten Rübenfäule (Rhizoctonia solani AG2-2) sowie auf<br />
den Befall der Zuckerrübe zu ermitteln. Da auch Mais Wirtspflanze des Pilzes ist, beinhaltet<br />
das Projekt auch Versuche mit Maissorten unterschiedlicher Anfälligkeit gegenüber R.<br />
solani und deren Einfluss auf das Erregerpotential innerhalb einer Fruchtfolge mit Zuckerrübe.<br />
Außerdem soll geklärt werden, ob mittels Quantifizierung des Erregers im Boden eine<br />
Risikoabschätzung des Befalls möglich ist. Dazu sollen Verfahren etabliert werden, die<br />
zum Nachweis und zur Quantifizierung von R. solani in natürlich infizierten Feldböden<br />
angewendet werden können.<br />
Methode<br />
In umfangreichen, mehrjährigen Feldversuchen wird getestet, ob und inwieweit sich verschiedene<br />
Fruchtfolgen (mit Vorfrucht Mais oder Winterweizen vor Zuckerrübe) bzw. unterschiedliche<br />
Maissorten (Lacta, Banguy, Fabregas) auf das Erregerpotential von R.<br />
solani im Boden auswirken. Zur Quantifizierung des Erregers in natürlich und künstlich<br />
inokulierten Feldböden kommen neben der Schadbonitur von Zuckerrübe und Mais auch<br />
Fangpflanzenverfahren im Feld, Fangpflanzentests im Phytotron sowie PCR-gestützte,<br />
molekularbiologische Nachweisverfahren (quantitative PCR) zum Einsatz. Als Fangpflanze<br />
wird die <strong>für</strong> R. solani besonders anfällige Ackerbohne (Vicia faba) verwendet. Diese<br />
wird u.a. in die in den Versuchsparzellen genommenen Bodenproben ausgesät, um anhand<br />
von Wurzelschäden sowie iomasse-Parametern den Befall unter kontrollierten Bedingungen<br />
quantifizieren zu können. Stichprobenartige PCR-gestützte Erreger-Nachweise bestätigen<br />
jeweils den Befall mit R. solani.<br />
Ergebnisse<br />
Die Ergebnisse des zweiten Versuchsjahres bestätigten den Trend des Vorjahres, dass die<br />
getesteten Maissorten unterschiedlich anfällig gegenüber R. solani sind, wobei die Sorte<br />
Banguy am anfälligsten zu sein scheint (siehe Abb.). Weiterhin konnte die R. solani-<br />
Inokulumdichte mittels Fangpflanzentests (Ackerbohne) im Feld, im Gewächshaus sowie<br />
im Phytotron gut abgebildet werden. Parallel zur Schadklassenbestimmung am Mais wurde