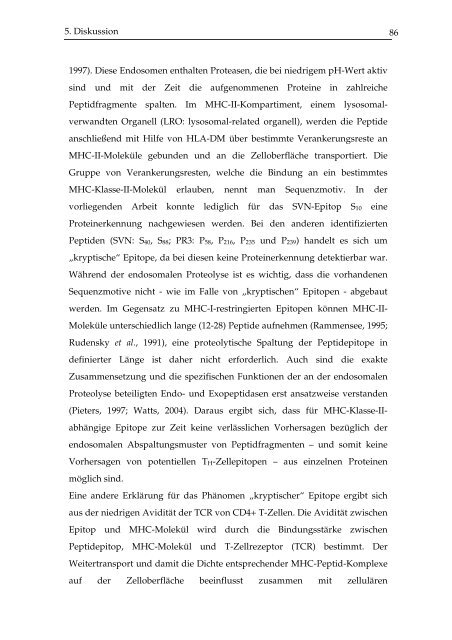Identifikation und immunologische Charakterisierung von MHC ...
Identifikation und immunologische Charakterisierung von MHC ...
Identifikation und immunologische Charakterisierung von MHC ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
5. Diskussion<br />
1997). Diese Endosomen enthalten Proteasen, die bei niedrigem pH-Wert aktiv<br />
sind <strong>und</strong> mit der Zeit die aufgenommenen Proteine in zahlreiche<br />
Peptidfragmente spalten. Im <strong>MHC</strong>-II-Kompartiment, einem lysosomal-<br />
verwandten Organell (LRO: lysosomal-related organell), werden die Peptide<br />
anschließend mit Hilfe <strong>von</strong> HLA-DM über bestimmte Verankerungsreste an<br />
<strong>MHC</strong>-II-Moleküle geb<strong>und</strong>en <strong>und</strong> an die Zelloberfläche transportiert. Die<br />
Gruppe <strong>von</strong> Verankerungsresten, welche die Bindung an ein bestimmtes<br />
<strong>MHC</strong>-Klasse-II-Molekül erlauben, nennt man Sequenzmotiv. In der<br />
vorliegenden Arbeit konnte lediglich für das SVN-Epitop S10 eine<br />
Proteinerkennung nachgewiesen werden. Bei den anderen identifizierten<br />
Peptiden (SVN: S40, S88; PR3: P58, P216, P235 <strong>und</strong> P239) handelt es sich um<br />
„kryptische“ Epitope, da bei diesen keine Proteinerkennung detektierbar war.<br />
Während der endosomalen Proteolyse ist es wichtig, dass die vorhandenen<br />
Sequenzmotive nicht - wie im Falle <strong>von</strong> „kryptischen“ Epitopen - abgebaut<br />
werden. Im Gegensatz zu <strong>MHC</strong>-I-restringierten Epitopen können <strong>MHC</strong>-II-<br />
Moleküle unterschiedlich lange (12-28) Peptide aufnehmen (Rammensee, 1995;<br />
Rudensky et al., 1991), eine proteolytische Spaltung der Peptidepitope in<br />
definierter Länge ist daher nicht erforderlich. Auch sind die exakte<br />
Zusammensetzung <strong>und</strong> die spezifischen Funktionen der an der endosomalen<br />
Proteolyse beteiligten Endo- <strong>und</strong> Exopeptidasen erst ansatzweise verstanden<br />
(Pieters, 1997; Watts, 2004). Daraus ergibt sich, dass für <strong>MHC</strong>-Klasse-II-<br />
abhängige Epitope zur Zeit keine verlässlichen Vorhersagen bezüglich der<br />
endosomalen Abspaltungsmuster <strong>von</strong> Peptidfragmenten – <strong>und</strong> somit keine<br />
Vorhersagen <strong>von</strong> potentiellen TH-Zellepitopen – aus einzelnen Proteinen<br />
möglich sind.<br />
Eine andere Erklärung für das Phänomen „kryptischer“ Epitope ergibt sich<br />
aus der niedrigen Avidität der TCR <strong>von</strong> CD4+ T-Zellen. Die Avidität zwischen<br />
Epitop <strong>und</strong> <strong>MHC</strong>-Molekül wird durch die Bindungsstärke zwischen<br />
Peptidepitop, <strong>MHC</strong>-Molekül <strong>und</strong> T-Zellrezeptor (TCR) bestimmt. Der<br />
Weitertransport <strong>und</strong> damit die Dichte entsprechender <strong>MHC</strong>-Peptid-Komplexe<br />
auf der Zelloberfläche beeinflusst zusammen mit zellulären<br />
86