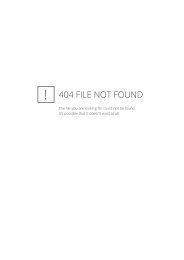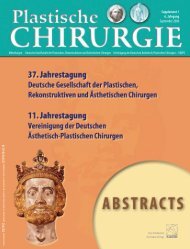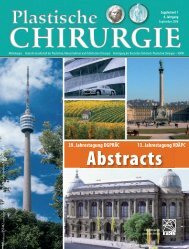Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Poster | Freitag | 17.9.<strong>2010</strong><br />
Hypothese: Der ALT-Perforator-Lappen kann mit Faszia lata gehoben und<br />
proximal gestielt zur Bauchdeckenrekonstruktion ohne Netzeinlage herangezogen<br />
werden.<br />
Methoden: Anhand der (spärlichen) Literatur und eines exemplarischen<br />
Falles aus unserer Klinik werden die Konditionen und die operative Vorgehensweise<br />
der Bauchdeckenrekonstruktion mit gestieltem ALT Lappen<br />
dargelegt.<br />
Kasuistik: Patientin, 76 J., Diabetes mellitus, nach Uterus CA vor 23 Jahren<br />
(mit OP und RTX behandelt) superinfiziertes zerfallendes Radioderm<br />
allschichtig des gesamten Unterbauchs(25×15 cm). Präoperative<br />
Bilder und CT belegen die Ausgangssituation.<br />
Ergebnisse: Spannungsfreie Rotation des Perforatorappens vom Oberschenkel<br />
zum Unterbauch ohne jegliche Durchblutungsstörung. Komplikationsloser<br />
Verlauf, Wundheilung per primam. Keine Bauchwandschwäche,<br />
keine Herniation (MRT Diagnostik postop.); großer Gewinn<br />
an Lebensqualität für die Patientin.<br />
Fazit: Der gestielte ALT-Perforatorlappen eignet sich gut zur Rekonstruktion<br />
von komplizierten allschichtiger Wunden im Unterbauch. Ausblick:<br />
Für alle komplizierten Wunden der Bauchwand, welche z.B. wegen Infektgefahr<br />
den Einsatz von Fremdmaterial (Netze) unmöglich machen,<br />
stellt der gestielte ALT-Lappen mit Fascia lata eine gute Behandlungsoption<br />
dar.<br />
P89 L sWOP (subcutaneous wash out procedure)<br />
als therapieoption zur behandlung von Extravasationen<br />
mit Chemotherapeutica<br />
Steiert A, Burke W, Gohritz A, Herold C, Vogt PM<br />
Medizinische Hochschule Hannover<br />
Extravasationen von Chemotherapeutika können Gewebenekrosen und<br />
Gewebedefekte zur Folge haben und zu Funktionsverlusten an Extremitäten<br />
führen. Ohne Therapie führen ein Drittel der Extravasationen mit<br />
potentiell gewebetoxischen Substanzen zu Ulzerationen, die in einigen<br />
Fällen eine mikrochirurgische Rekonstruktion erfordern. Ziel der Arbeit<br />
ist die chirurgische Technik (SWOP), die Indikation zu SWOP entsprechend<br />
unterschiedlicher Substanzklassen von Chemotherapeutika und<br />
die Ergebnisse unserer Patientenserie, bei denen wir SWOP durchführten,<br />
darzustellen.<br />
Hypothese: Durch die Durchführung von SWOP werden potentiell gewebetoxische<br />
Extravasationen verdünnt und abgesaugt, um damit das Risiko<br />
von Ulzerationen zu verringern.<br />
Patienten und Methode: In einem Zeitintervall von drei Jahren führten wir<br />
SWOP bei 13 weiblichen Patientinnen mit Extravasationen von Chemotherpeutika<br />
durch. Neun Patientinnen erlitten ein Paravasat mit stark<br />
gewebetoxischen Eigenschaften und vier Patientinnen mit weniger stark<br />
gewebetoxischen Eigenschaften.<br />
Ergebnisse: Das durchschnittliche Intervall zwischen Extravasation und<br />
SWOP betrug 345 (140–795) min. In keinem Fall kam es zu Ulzerationen<br />
oder Gewebedefekten. Die inflammatorische Reaktion des Gewebes<br />
war nach der Durchführung von SWOP stetig rückläufig. In einem<br />
Nachbeobachtungsintervall von drei Monaten traten keine weiteren<br />
Komplikationen auf.<br />
Fazit: Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass SWOP eine minimalinvasive,<br />
sichere und effective Methode darstellt, um die Wahrscheinlichkeit<br />
von Komplikationen nach Extravasationen mit Chemotherapeutika<br />
zu reduzieren. Vergleichende Studien zur Effektivität der konservativen<br />
Therapie von Extravasaten mit Chemotherapeutika existieren nicht. Daher<br />
sollte die therapeutische Option zur Durchführung von SWOP den<br />
Patienten angeboten werden.<br />
Plastische Chirurgie 10 (Suppl. 1): 105 (<strong>2010</strong>)<br />
Abstracts<br />
P90 L Der s-GAIF – eine Reservemethode zur Deckung<br />
des komplexen, lumbalen Defektes<br />
O‘Dey DM, Gröger A, Pallua N<br />
Universitätsklinikum Aachen<br />
Die Komplexität lumbaler Gewebedefekte bedingt nicht selten eine Minimierung<br />
verfügbarer Optionen zur Defektdeckung. Die Glutealregion<br />
bietet eine Gefäßarchitektur die vielseitig zur Integration in Lappenplastiken<br />
genutzt werden kann und zudem eine günstige Lagebeziehung zur<br />
Lumbalregion aufweist.<br />
Methode: An einem Fallbeispiel werden häufig vorgefundene Probleme<br />
lumbaler Defekte, sowie die anatomische Basis und das operative Konzept<br />
einer sich auf die A. glutealis superior stützenden, muskulokutanen<br />
Insellappenplastik (superior gluteal artery island flap; kurz S-GAIF) zur<br />
Defektdeckung vorgestellt.<br />
Ergebnisse: Der S-GAIF zeigt eine stabile, axiale Durchblutung und gute<br />
geometrische Eigenschaften zur Deckung des komplexen, lumbalen Defektes.<br />
Insbesondere bei freiliegendem Osteosynthesematerial der Wirbelsäule<br />
bietet das muskulokutane Lappendesign eine suffiziente Defektdeckung.<br />
Der Verschluss der Hebestelle erfolgt primär.<br />
Fazit: Der S-GAIF bietet bei entsprechender Indikation eine sichere Reservemethode<br />
zum lokoregionalen Verschluss des schwierigen, lumbalen<br />
Defektes bei vertretbarer Hebemorbidität.<br />
P91 L Plastisch-chirurgische Deckung perinealer<br />
Defekte nach tumorresektion im Rahmen interdisziplinärer<br />
Operationen<br />
Hierner R, Niebel W, Wimberger P, Kimmig R<br />
Universitätsklinikum Essen<br />
Bei den meisten Patienten stellt der Wundschluss nach anteriorer pelvino<br />
rektaler Rektumamputation (APRA) kein Problem dar. In Fällen<br />
mit vorausgegangener Bestrahlung oder pararektaler Tumorinfiltration<br />
kann jedoch eine plastische Deckung notwendig werden. Bei dieser Patientengruppe<br />
hat sich an unserer Klinik eine multidisziplinäre Versorgung<br />
bestens bewährt.<br />
Patienten und Methode: Im Zeitraum von 2002 und 2009 wurde bei 25 Patienten<br />
ein ausgedehnter pelviner Defekt nach APRA gedeckt. Die Operation<br />
erfolgte bei 10 Männer und 15 Frauen. Das Patientenalter betrug<br />
36–78 Jahre. In einer retrospektiven klinischen Studie wurden folgende<br />
Kriterien untersucht: 1) Art der Lappenplastik, 2) Operationsdauer, 3)<br />
intraoperativer Blutverlust, 4) Hospitalisationsdauer, 5) Mobilisation,<br />
und 6) Art und Anzahl von Komplikationen.<br />
Ergebnisse: Die Defektdeckung erfolgte mithilfe einer bilateralen Glutaeus-maximus<br />
Lappenplastik (15), gestielten myokutanen Rectus-abdominis-Lappenplastik<br />
(4) und einer gestielten M.-gracilis-Lappenplastik<br />
(6). Der durchschnittliche intraoperative Blutverlust, die Operationsdauer<br />
und die Dauer der Hospitalisation waren bei der Rectus-abdominis<br />
Lappenplastik am längsten. Ein Patient mit bilateraler Glutaeus<br />
maximus Lappenplastik verstarb unmittelbar postoperativ. Bei den restlichen<br />
24 Patienten trat im weiteren Verlauf mindestens eine frühe oder<br />
späte Komplikation ein, wobei die Rectus-abdominis Lappenplastik die<br />
niedrigste Komplikationsrate aufwies. 2 Jahre nach Operation waren<br />
noch 18 Patienten am Leben. 13 zeigten eine geringe funktionelle Beeinträchtigung<br />
bei Gehen, Sitzen oder Fahrrad fahren, bei 5 Patienten<br />
bestanden neurogene Beschwerden.<br />
105