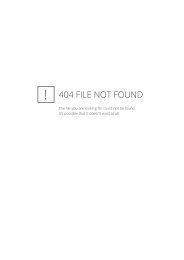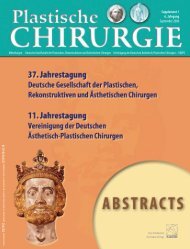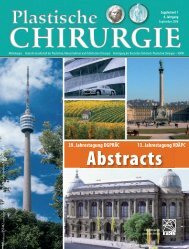Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Abstracts<br />
consistency and the territory of vascular distribution of this flap using<br />
cadaver specimens and showed that muscle tissue can easily be added as<br />
a composite graft.<br />
Methods: 21 osteo-musculo-cutaneus flaps from the medial femoral condyle<br />
were harvested from eleven preserved adult cadavers acquired through<br />
the Willed Body Program of the University of Tuebingen, Germany. All<br />
specimens were injected with a silicone polymeric compound and dissected<br />
out with careful identification of the origin and course of the three<br />
different branches of the descending genicular artery (DGA).The corresponding<br />
skin areas and muscle portion were identified. In addition, application<br />
of the free osteo-musculocutaneus flap from the medial femur<br />
condyle was described for closure of complex calcaneal defects.<br />
Result: The cadaver study presented a constant pedicle length and diameter<br />
of the arteries combined with a constant venous drainage provided<br />
by the paired venae comitantes of the DGA. Furthermore, the internal<br />
condyle provided a cortico-cancellous bony segment of good quality and<br />
separate vascularity from skin and muscle portions. In the case reports,<br />
satisfying results of bone union and soft tissue contouring were achieved.<br />
The donor sites at the medial femur condyle showed good postoperative<br />
courses of healing.<br />
Conclusion: The medial femur condyle region is a reliable donor site for<br />
composite flaps, providing a good cortico-cancellous bony structure and<br />
a separate thin skin paddle, as well as a muscle portion. Its vascular distribution<br />
shows anatomical consistency. Using additional muscle tissue<br />
may increase the chance of flap survival and provide better soft tissue<br />
contouring.<br />
V163 L Möglichkeiten und Grenzen der einzeitigen Defektdeckung<br />
von denudiertem Knochen und freiliegenden<br />
sehnen mittels dermaler Matrix Matriderm und spalthaut<br />
Heckmann A, Radtke C, Jukoszies A, Weyand B, Rennekampff H-O, Vogt PM<br />
Medizinische Hochschule Hannover<br />
Vollschichtige Hautdefekte über denudiertem Knochen oder freiliegenden<br />
Sehnen an den Extremitäten machen in der Regel aufwendige plastisch-rekonstruktive<br />
Operationen zur Defektdeckung notwendig. Als<br />
Option bei der Defektdeckung steht die bovine Kollagen-Elastin-Matrix<br />
Matriderm zur Verwendung als Neodermis unter Hauttransplantaten<br />
zur Verfügung.<br />
Hypothese: Kann die einzeitige Transplantation mit Matriderm und Spalthaut<br />
über denudierten Knochen oder freiliegenden Sehnen eine suffiziente<br />
Defektdeckung erreichen?<br />
Methoden: Bei insgesamt 10 Patienten wurde anstatt aufwendig plastischchirurgischer<br />
Defektdeckung Matriderm in Kombinatin mit einem<br />
Hauttransplantat in einem einzeitigen Deckungsverfahren verwandt. Es<br />
wird die Einheilung der Hauttransplantate auf denudiertem Knochen<br />
und Paratenon freien Sehnen dargestellt.<br />
Ergebnisse: Bei 9 von 10 Patienten konnte mit dem kombinierten Verfahren<br />
durch Matriderm und Hauttransplantation eine vollständige Defektdeckung<br />
erzielt werden. Dabei war ein einzeitiger Wundverschluss<br />
über freiliegenden Sehnen ohne Paratenon in 4 von 5 Lokalisationen<br />
unter Erhalt der Funktion zu erreichen gewesen. Über deperiostierten<br />
knöchernen Defekten ist ein einzeitiger komplikationsfreier Verschluss<br />
jedoch nur in 2 von 6 Lokalisationen erfolgreich gewesen. Insgesamt<br />
konnte jedoch mit einer zweiten Hauttransplantation bei vaskularisiertem<br />
Matriderm ein vollständiger Wundverschluss an einer Wunde mit<br />
freiliegender Sehne und in 3 der 4 knöchernen Lokalisationen erzielt<br />
werden.<br />
Fazit: Durch die ein- bzw. zweizeitige Verwendung von Matriderm über<br />
frei liegenden Sehnen sowie Knochen kann ein effektiver Defektver-<br />
schluss erzielt werden. Durch die ein- und zweizeitige Verwendung von<br />
Matriderm besteht eine erweiterte Indikationsmöglichkeit für Spalthauttransplantationen<br />
bei plastisch-rekonstruktiven Eingriffen. Eine<br />
klinisch vergleichende Studie muss zeigen, ob durch diese Kombination<br />
Lappenplastiken funktionell und ästhetisch ersetzt werden können.<br />
V164 L Vacuum-assisted closure (VAC) vs. Fettgazeverband<br />
bei spalthautentnahmestellen: Eine randomisiertkontrollierte<br />
studie<br />
Stasch T, Sauerland S, Brockmann M, Phan TQV, Spilker G<br />
Klinikum Köln-Merheim, Universität Witten/Herdecke<br />
Vorträge | Samstag | 18.9.<strong>2010</strong><br />
Spalthautentnahmestellen werden von Patienten oft als schmerzhaft<br />
angesehen. Bei Schwerstverbrannten Patienten bieten nichtverbrannte<br />
Areale oft die einzige Möglichkeit, durch serielle Spalthautentnahmen<br />
eine adäquate und lebensrettende Wunddeckung zu erreichen. Der ideale<br />
Wundverband bei Spalthautentnahmestellen fördert die Wundheilung<br />
durch schnelle Reepithelialisation, ist schmerzfrei und verursacht minimale<br />
Narbenbildung. Die VAC-Therapie wird oft bei tieferen Wunden<br />
zur schnelleren Wundheilung eingesetzt. In der Literatur wird dem Unterdrucksystem<br />
heilungsfördernde Wirkung durch Reduktion von Ödem<br />
und Exudation, Infektion, und Förderung der Durchblutung des Gewebes<br />
zugeschrieben. In einer standardisierten Wunde, wie der Spalthautentnahmestelle,<br />
kann dies geprüft werden.<br />
Hypothese: In dieser randomisiert kontrollierten Studie wurde die Hypothese<br />
getestet, dass ein VAC-Verband, verglichen mit dem konventionellen<br />
Fettgazeverband, die Reepithelialisierungsrate und somit die Wundheilung<br />
von oberflächlichen Wunden fördert.<br />
Methoden: Zwischen Februar und Juni 2009 wurden 11 Patienten in<br />
diese intraindividuelle Vergleichsstudie eingeschlossen. Mittels Münzwurfs<br />
wurde intraoperativ entschieden, welche der zwei gleichgroßen<br />
Spalthautentnahmewunden mit dem VAC-Verband (PVA Schaumstoff<br />
und kontinuierlicher Unterdruck von 125 mmHg), und welche mit der<br />
Fettgaze verbunden werden. Während der Verbandswechsel am 4., 7.,<br />
9., 11. und 13. Tag wurden 2.5 mm Hautstanzen entnommen, um den<br />
Fortschritt der Wundheilung histologisch zu verfolgen, und die Wunden<br />
fotografiert. Die histologische und klinische Auswertung der Wundheilung<br />
wurde im Anschluss verblindet durchgeführt. Der Fortschritt der<br />
Reepithelisierung wurde als primäres Zielkriterium gewählt, während<br />
Schmerzen bei und während der Wundbehandlung, Infektions und<br />
Komplikationsrate, Kosten und Narbenbildung (nach 30 Tagen) sekundäre<br />
Zielkriterien bildeten. Die untersuchten histologischen Parameter<br />
beinhalteten die Epitheldicke, Integrität des Kollagens, Dicke der Neodermis,<br />
und Anzahl der Leukozyten.<br />
Ergebnisse: Die Wundgrößen waren vergleichbar zwischen den beiden<br />
Gruppen (VAC-Gruppe 101±86 cm² vs. 100±65 cm² in der Fettgaze<br />
Gruppe, p=0,89). Die mediane Zeit bis zur kompletten Reepithelialisierung<br />
war signifikant schneller in der Fettgazegruppe (7 vs. 13 Tage,<br />
p =0,032). Histologisch wurde eine signifikant frühere Wundheilung<br />
dokumentiert als durch klinische Beobachtung (p=0,036). Die Infektionsrate,<br />
Kosten und Narbenbildung (gemessen mittels Vancouver Scar<br />
Scale) waren höher in der VAC-Gruppe, während Schmerzempfinden in<br />
den ersten 4 postoperativen Tagen signifikant geringer war bei diesen<br />
Patienten (Visual Analogue Scale Mittelwerte 0,7 (0,6) vs. 3,0 (1,2),<br />
p=0,001).<br />
Fazit: Obwohl die VAC-Therapie weniger schmerzhaft und angenehmer<br />
für die Patienten mit oberflächlichen Wunden ist, fördert sie weder die<br />
Wundheilungsrate gemessen am Reepithelialisierungsgrad, noch verringert<br />
sie die Infektionsrate oder Narbenbildung im Vergleich mit konventionellen<br />
Fettgazeverbänden.<br />
64 Plastische Chirurgie 10 (Suppl. 1): 64 (<strong>2010</strong>)