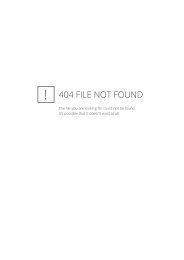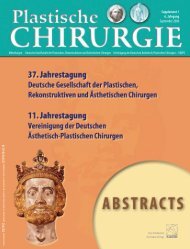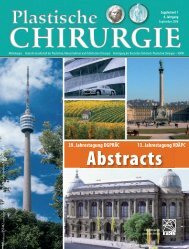Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Abstracts<br />
Fazit: Das seltene Krankheitsbild eines MPNST sollte bei Patienten mit<br />
kutanen und subkutanen Tumoren und bekannter Neurofibromatose<br />
differentialdiagnostisch erwogen werden. Insbesondere sollte bei schnellem<br />
Wachstum, diffuser Ausbreitung/Infiltration und inhomogener<br />
Textur, muss an eine maligne Transformation gedacht werden Die Standardtherapie<br />
besteht in der radikalen und vollständigen Entfernung in<br />
Kombination mit adjuvanter Strahlentherapie.<br />
Posterpräsentationen III<br />
Donnerstag, 15:15–16:15 Uhr, Seminarraum 3<br />
P30 L AmbLOXe – Eine amphibische epidermale Lipoxygenase<br />
und ihr Einfluss auf humane Wundassays in vitro<br />
Menger B, Reimers K, Kuhbier JW, Kiliat J, Nasser I, Sorg H, Radtke C, Vogt PM<br />
Medizinische Hochschule Hannover<br />
Amphibische Regeneration stellt ein beeindruckendes biologisches<br />
Phänomen dar. Während der humanen Wundheilung enge Grenzen gesetzt<br />
sind, zeigt beispielsweise der mexikanische Axolotl (Ambystoma<br />
mexicanum) eine vollständige Regeneration amputierter Gliedmaßen.<br />
Aktuelle Studien und eigene Vorarbeiten deuten auf einen potentiellen<br />
Nutzen amphibischer Mechanismen für die humane Wundtherapie hin.<br />
Hypothese: In Vorarbeiten der Arbeitsgruppe konnte eine epidermale Lipoxygenase<br />
(AmbLOxe) des mexikanischen Axolotls kloniert und eine<br />
erhöhte Expression im Regenerationsgewebe nachgewiesen werden. Da<br />
Lipoxygenasen ebenso maßgeblich an humanen Wundheilungsprozessen<br />
beteiligt sind, stellt sich die Frage nach einem etwaigen Ansprechen<br />
humaner Zellen auf amphibische Lipoxygenasen.<br />
Methoden: AmbLOXe-kodierende Sequenzen wurden in einen Säuger-<br />
Expressionsvektor (pTriEX-1) subkloniert. Im Anschluss erfolgte die<br />
Transfektion der humanen spontan immortalisierten Keratinozyten-<br />
Zelllinie HaCat mittels Fugene G unter Zusatz einer Green Fluorescent<br />
Protein (GFP) kodierenden Sequenz. Durch flow cytometry erfolgte die<br />
Identifikation AmbLOXe-positiver Kolonien (12 %) sowie der PCR-basierte<br />
Nachweis der Expression. Zur Etablierung von Vergleichsgruppen<br />
erfolgte die Transfektion einer humanen epidermaler Lipoxygenasen<br />
Sequenz (humLOX), sowie eines Leer-Vektors in HaCat Zellen. Alle<br />
Gruppen wurden nach Erreichen der Konfluenz einem Scratch-Assay<br />
unterzogen und die resultierende Wundspaltweite mikrofotografisch dokumentiert.<br />
Nach 16 h Inkubation erfolgte die Auswertung mittels Cell<br />
D (Olympus) im Hinblick auf die mittlere Wundspaltreduktion in den<br />
verschiedenen Gruppen.<br />
Ergebnisse: Die mittlere Wundspaltreduktion in AmbLOXe-exprimierenden<br />
HaCat-Populationen zeigte sich gegenüber der humanen Vergleichspopulationen<br />
(p=0,028) und der Kontrollgruppe (p=0,0035)<br />
signifikant erhöht.<br />
Fazit: Im Rahmen dieser Arbeit konnte ein Einfluss der amphibischen<br />
epidermalen Lipoxygenase (AmbLOXe) auf humane epidermale Zellen<br />
in vitro gezeigt werden. Dies deutet auf einen evolutionär konservierten<br />
Signalweg hin.. Der beschleunigte Wundschluss in vitro ist ein Indiz für<br />
einen etwaigen positiven Einfluss der AmbLOXe auf humane Wundheilungsvorgänge,<br />
bedarf aber weiterer Untersuchungen im Hinblick auf<br />
den AmbLOXe Signalzusammenhang, sowie der Effekte im Säugermodell.<br />
P31 L Das Forschungsprojekt QUtIs 3D:<br />
Wunddokumentation auf Grundlage virtueller<br />
dreidimensionaler Patienten<br />
Giretzlehner M, Dirnberger J, Owen R, Haller H, Kamolz L-P<br />
RISC Software GmbH, Hagenberg/Linz, Medizinische Universität Wien<br />
Poster | Donnerstag | 16.9.<strong>2010</strong><br />
Eine erfolgreiche Wundbehandlung wird im entscheidenden Ausmaß<br />
von der Transparenz der Behandlung und deren Objektivierung bestimmt;<br />
diese Objektivierung setzt Vergleichbarkeit – vergleichbare<br />
Patienten, vergleichbare Wunden und deren vergleichbare Dokumentationsqualität<br />
– und die damit verbundenen Analysen voraus. Für eine<br />
Erfolgsbeurteilung einer Therapie ist eine Wunddokumentation mit<br />
chronologischer und formaler Dokumentation erforderlich.<br />
Hypothese: Für die geforderte Vergleichbarkeit ist eine EDV-basierte<br />
strukturierte Dokumentation, welche eine möglichst eindeutige Erfassung<br />
von Sachverhalten mit quantitativen Merkmalen zulässt, ein zwingendes<br />
Muss. Die Anforderungen an ein zeitgemäßes EDV-basiertes<br />
Wunddokumentation sind primär eine chronologische und formale Dokumentation<br />
des Wundzustandes. Denn nur dadurch über einen längeren<br />
Zeitraum, kann eine Erfolgsbeurteilung der aktuellen Therapie<br />
durchgeführt werden. Weiters dient sie als Kommunikationsmittel zwischen<br />
den an der Therapie beteiligten Personen. Zusätzlich kann sie als<br />
sinnvolles Werkzeug auf dem Gebiet der Qualitätskontrolle, Qualitätssicherung,<br />
Schulung, Abrechnung und rechtlichen Absicherung dienen.<br />
Methoden: Das Forschungsprojekt Qutis 3D verwendet einen neuartigen<br />
und intuitiven Zugang zu den notwendigen Informationen auf Grundlage<br />
eines dreidimensionalen virtuellen Patienten. Informationen zur<br />
Wunde, Verbände, Befunde, Dokumente und eine umfassende Fotodokumentation<br />
werden direkt auf dem virtuellen Patienten positioniert<br />
und über diesen wieder zugänglich gemacht. Die auf zwei Dimensionen<br />
reduzierten Fotos von Wunden können durch semiautomatische Projektion<br />
auf das dreidimensionale Modell übertragen werden. Durch diese<br />
Rückprojektion bleibt die dreidimensionale Beschaffenheit der Wunde<br />
in der Dokumentation erhalten.<br />
Ergebnisse: Viele Systeme erfüllen zwar einen großen Teil dieser Anforderungen,<br />
der Schwerpunkt liegt aber zumeist auf der Dokumentation einzelner<br />
Patienten. Der Forderung nach einer umfassenden Datensammlung<br />
für Studien und somit für die Schaffung einer wissenschaftlichen<br />
Grundlage eines medizinischen Experten- oder Entscheidungsunterstützungssystems<br />
wurde bisher noch nicht ausreichend nachgekommen.<br />
Fazit: Qutis 3D soll diese strukturierte Dokumentation ermöglichen und<br />
somit wissenschaftlich auswertbare Daten schaffen, die als Grundlage<br />
für Studien und zur Erstellung eines weltweiten Expertensystems für<br />
die Wundversorgung dienen können.<br />
P32 L Vorstellung eines neuartigen In-vivo-Wundmodells<br />
zur Analyse der Wirkung extrakorporaler<br />
stoßwellen auf Mikrozirkulation und Angiogenese<br />
Zwetzich I, Dorfmann O, Langer S, Steinau H-U, Dorfmüller C, Ottomann C, Ring A<br />
BG-Universitätsklinikum Bergmannsheil Bochum<br />
In den letzten Jahren häufen sich Berichte über die positive Wirkung von<br />
extrakorporalen Stoßwellen (EKSW) auf die Wundheilung. Jedoch ist<br />
der pathophysiologische Mechanismus bis heute unklar. Es ist bis dato<br />
unmöglich geblieben den Effekt auf die Mikrozirkulation bis ins Detail<br />
zu analysieren. Die Energie der Stoßwellen leitet sich durch Gewebe<br />
ähnlich akustischer Impedanz fort und ist durch positiven und negativen<br />
Druck definiert. Der entscheidende Parameter für die Nebenwirkungen,<br />
84 Plastische Chirurgie 10 (Suppl. 1): 84 (<strong>2010</strong>)