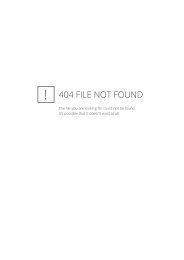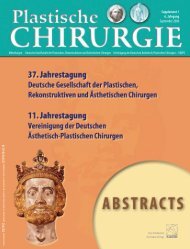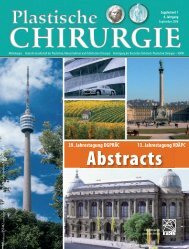Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Abstracts<br />
26,6e+09±3,75 [MW±SA]. Nach dem Waschvorgang betrug die Restsignalstärke<br />
der vitalen Fettcluster 4,61e+09±2,47 [MW±SA] und bei<br />
den thermisch avitalisierten Zellen 2,48e+09±2,10 [MW±SA]. Die<br />
durchschnittliche Signalabnahme nach zwei Waschvorgängen als indirekter<br />
Anheftungsmarker ergab bei den vitalen Fettkonglomeraten somit<br />
58,8 % des Initialsignals (100 %) und 9,32 % bei den avitalisierten<br />
Fettclustern. Die Fluoreszenzstärke der subcutanen Injektionen im Rückenbereich<br />
mit QDots und Cardiogreen wurde 38 Tage lang (Tag 1–7,<br />
11, 17, 24, 31 und 38) in vivo gemessen. Die QDots-Injektionen wiesen<br />
eine Signalrate von 6,38e+10±1,85 [MW±SA] am 1. Tag auf. Das<br />
Signal zeigte eine kontinuierliche Signalabnahme auf 1,23e+10±0,45<br />
[MW±SA] am 38. Tag. Die relative Signalstärke betrug am 38. Tag<br />
19,32 % des Initialwertes (100 %). Die Cardiogreen Injektionen zeigten<br />
ein initiales Signal von 33,24e+10±10,18 [MW±SA], und am 38. Tag<br />
0,53e+10±0,28 [MW±SA], was einer Reduktion um 98,41 % des Initalsignals<br />
entsprach. Bei Cardiogreen konnte eine enterale Elimination<br />
nachgewiesen werden.<br />
Fazit: Negativ geladene Quantum Dots zeigten eine bessere Anheftung<br />
bei vitalen Fettclustern im Vergleich zu avitalisierten Fettclustern. In<br />
vivo zeigten die puren QDots nach über 4 Wochen noch ein ausreichendes<br />
Signal und konnten am Injektionsort stabil detektiert werden. Daher<br />
scheinen nanotechnisch hergestellte negativ geladene QDots einen potentiellen<br />
Zelltracer für die Fettzelltransplantation darzustellen.<br />
V173 L Die Gewinnung therapeutisch nutzbarer<br />
(stamm-)Zellfraktionen aus humanem Fettgewebe<br />
Spanholtz TA, Thamm OC, Basnaoglu S, Neugebauer E, Spilker G<br />
Klinikum Köln-Merheim, Universität Witten/Herdecke<br />
Humanes Fett gilt als einfach zu erreichendes Gewebe und als Quelle<br />
zellulären Materials für Lipofilling und mesenchymaler Stammzellen,<br />
so genannter adipose-derived stem cells (ASC). Die Charakterisierungsmerkmale<br />
dieser ASC unterliegen einem stetigen Wandel in der Literatur.<br />
Die führt zu uneinheitlichen Isolationsprotokollen.<br />
Hypothese: Die Mengen gewonnener ASC hängt von der Gewinnung (liposuktioniert<br />
vs. exzidiert) und Aufbereitung des Fettgewebes ab.<br />
Methoden: Im Rahmen einer experimentellen In-vitro-Untersuchung erprobten<br />
wir verschiedene Protokolle zur Gewinnung der ASC-Fraktion<br />
aus liposuktioniertem und exzidiertem Fettgewebe. Wir führten jeweils<br />
(i) Zellzählungen aus der Primärkultur, (ii) Immunzytochemien und<br />
(iii) Differenzierungsversuche in verschiedene Zelltypen durch. Hiernach<br />
wurde die Kryokonservierbarkeit überprüft. Die gewonnenen<br />
Ergebnisse wurden mit den verfügbaren Daten aus der Literatur verglichen,<br />
um ein optimales „Handling-Protokoll“ für ASC zu erarbeiten.<br />
Ergebnisse: Mehrere Protokolle aus der Literatur zur Isolation von ASC<br />
wurden einander gegenübergestellt und bezüglich isolierbarer Anzahl<br />
unbeschädigter Zellen verglichen. Die Anzahl hängt von der Technik<br />
der Fettgewebsgewinnung und Aufbereitung ab. In Lipoaspirat fanden<br />
wir durchschnittlich 30 % rupturierte Zellen, während dieser Anteil<br />
in exzidiertem Fettgewebe bei durchschnittlich 7 % lag. Aus der zentrifugierten<br />
stromavaskulären Fraktion (SVF) von 1 g liposuktioniertem<br />
Fettgewebe wurden durchschnittlich 6,5×103 ASC, aus 1g solidem Fettgewebe<br />
1×106 ASC isoliert. Durch Immunzytochemie und Differenzierung<br />
wurde der Stammzellcharakter jeder Kultur überprüft.<br />
Fazit: Die Isolation und Charakterisierung adipöser Stammzellen hängt<br />
von der Technik bei Isolation und Aufbereitung ab. Diese Parameter beeinflussen<br />
die Anzahl intakt gewonnener ASC. Es gibt in der Literatur<br />
lediglich einen minimalen Konsens über den Nachweis des Stammzellcharakters.<br />
Zellen, die als ASC verwendet werden sollen müssen mindestens<br />
diesen Kriterien entsprechen.<br />
V174 L Eugen Holländer (*1867, †1932) – ein weitgehend<br />
unbekannter begründer der ästhetischen Chirurgie,<br />
Fettinjektion und medizinischen Kunstgeschichte in<br />
Deutschland<br />
Gohritz A, Knobloch K, Vogt PM<br />
Medizinische Hochschule Hannover<br />
Vorträge | Samstag | 18.9.<strong>2010</strong><br />
Die Vorteile der autologen Transplantation von Fett zur ästhetischen<br />
und rekonstruktiven Weichteilkorrektur wurden in den letzten Jahren<br />
wiederentdeckt, die ersten Versuche zur minmal invasiven Fettinjektion<br />
wurden jedoch schon 1908 von dem Berliner Chirurgen Eugen Holländer<br />
(1967–1932) durchgeführt, der weitgehend in Vergessenheit geraten ist.<br />
In diesem Vortrag soll an das Leben und Werk dieses frühen Pioniers erinnert<br />
werden, wobei besonders auf seine Beiträge zu Lipofilling im Gesicht,<br />
Face-lift, Brustreduktion eingegangen wird, aber auch auf seine Verdienst<br />
als Begründer der medizinischen Kunstgeschichte in Deutschland.<br />
Ergebnisse: Holländer erhielt seine plastisch-chirurgische Aubildung in 15<br />
Jahren bei James Israel, dem weltbekannten Pionier der Nierenchirurgie<br />
und Gesichtsrekonstruktion am Jüdischen Krankenhaus in Berlin,<br />
widmete sich später vor allem der ästhetischen plastischen Chirurgie<br />
und behandelte viele berühmte Patienten in Berlin, z. B. den Shah von<br />
Persien. Im Jahre 1901, wie er später berichtete, nahm Holländer, „verführrt<br />
von weiblicher Überredungskunst“, an einer polnischen adeligen<br />
Patienten eine chirurgische Gesichtsstraffung vor. 1925 stellte er eine<br />
Technik zur Behandlung der „Hängebrust“ vor. 1910 berichtete er über<br />
„Ein Fall von progressiver Fettatrophie und seinen kosmetischen Ersatz<br />
durch humanes Fett“. Bei einer Frau mit Gesichtsatrophie. Er injizierte<br />
eine Mischung aus menschlichem und Hammelfett, um eine Reabsorption<br />
zu vermindern und die damals berüchtigten Komplikationen einer<br />
Paraffineinspritzung zu vermeiden. Die Patientin war mit dem Ergebnis<br />
„sehr zufrieden“ und Holländer wandte danach Fettinjektionen auch bei<br />
Brustdeformitäten nach Mastektomie an. Holländers einzigartige Sammlung<br />
Tausender von medizinisch interessanten Kulturgegenständen und<br />
Gemälden ging leider im Zweiten Weltkrieg verloren, kann aber in seinen<br />
zahlreichen Büchern, z. B. „Medizin in der Klassischen Malerei“<br />
(1905), „Karikatur und Satire in der Medizin“ (1905) und „Plastik und<br />
Medizin“ (1912) bewundert werden. Holländer verstarb 1932 an einem<br />
Schlaganfall, sein Ruhm wurde unterdrückt, weil er Jude war. Seine Familie<br />
wurde zur Emigration gezwungen.<br />
Fazit: Eugen Holländer war ein vielfach begabter Chirurg, dessen Werk<br />
interessante Einblicke in die Geschichte der ästhetischen Chirurgie bietet<br />
und aus kultureller Sicht für jeden interessierten Plastischen Chirurgen<br />
Inspiration und Bereicherung ist.<br />
V175 L Rekonstruktive Eingriffe an der brust durch<br />
Eigenfett-transplantation<br />
Heine N, Brebant V, Markovicz M, Prantl L, Eisenmann-Klein M<br />
Caritas-Krankenhaus St. Josef Regensburg; Universitätsklinikum Regensburg<br />
Seit Juni 2007 werden an unserer Abteilung Operationen an der weiblichen<br />
Brust durch Lipofilling mit autologem Fettgewebe durchgeführt.<br />
Von Beginn an wurde hierbei der Unterdruck-BH (Typ BRAVA, entwickelt<br />
von Roger Khouri aus Miami) eingesetzt. Ermutigt durch Ergebnisse<br />
zur Verbesserung der Ästhetik sowie bei angeborenen Fehlbildungen,<br />
wurde die Technik zunehmend auch zur Brustrekonstruktion nach<br />
Mamma-Ca. herangezogen.<br />
Hypothese: Die rekonstruktiven Verfahren stellen seit vielen Jahren einen festen<br />
Bestandteil der operativen Brustchirurgie dar. Neben dem Einsatz von<br />
68 Plastische Chirurgie 10 (Suppl. 1): 68 (<strong>2010</strong>)