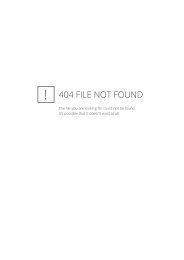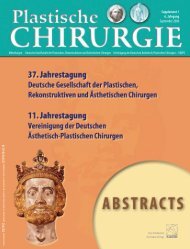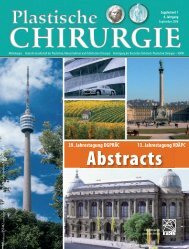Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Vorträge | Freitag | 17.9.<strong>2010</strong><br />
temperatur um ein Grad Celsius reduzierte den mikrozirkulatorischen<br />
Blutfluss um 40 relative Einheiten.<br />
Fazit: Die Hauttemperatur bei freien Lappenplastiken ist abhängig vom<br />
mikrozirkulatorischen Blutfluss der Lappenplastik. Unsere Hypothese<br />
ist somit bestätigt. In Zukunft könnte die regelmäßige Erhebung der<br />
Lappentemperatur ein reliables und zudem ökonomisches Monitoringverfahren<br />
in der rekonstruktiven Plastischen Chirurgie darstellen.<br />
V133 L Messung der Gewebeperfusion von humaner<br />
Haut nach und während einer Unterdruckvakuum-Anlage<br />
Dragu A, Münchow S, Kneser U, Horch RE<br />
Universitätsklinikum Erlangen<br />
Die Unterdruckvakuumtherapie hat sich innerhalb der letzten 10 Jahre<br />
in der Behandlung von chronischen und traumatischen Wunden klinisch<br />
etabliert. So haben in der Vergangenheit klinische Studien erstaunliche<br />
Ergebnisse bei der Wundheilung von sonst therapierefraktären Wunden<br />
aufzeigen können. Als mögliche Ursachen werden besonders der Abtransport<br />
von Wundsekret, die Induktion von Wundgrundgranulation,<br />
die Verkleinerungstendenz der Wunde durch das Vakuum und die Perfusionssteigerung<br />
des Gewebes diskutiert. Letzteres und insbesondere die<br />
Mechanismen auf zellulärer und molekularer Ebene sind jedoch nicht<br />
abschließend verstanden.<br />
Hypothese: Die Gewebeperfusion wird durch die Unterdruckvakuumtherapie<br />
gesteigert.<br />
Methoden: Es wurde bisher 20 gesunde freiwillige Probanden in die Studie<br />
eingeschlossen. Bei allen 20 Probanden wurde zunächst in einer<br />
ersten Baseline-Messung (I) die Gewebeperfusion am lateralen Oberschenkel<br />
bestimmt. Hierbei wurden mit einer kombinierten Laserdoppler-<br />
und Spektroskopsonde folgende 3 Parameter gemessen: (A)<br />
Sauerstoffsättigung [%], (B) post-kapilläre venöse Füllung [relative<br />
Einheiten] und (C) Blutflussrate [relative Einheiten]. Hierzu wurde das<br />
Oxygen-To-See (O2C) Gerät der Firma LEA Medizintechnik (Giessen,<br />
Deutschland) verwendet. Schließlich erfolgte eine 30minütige Anlage<br />
eines Unterdruckvakuumschwammes mit 125 mmHg auf den jeweiligen<br />
Oberschenkel, wobei die Messsonde auf der Haut, d.h. unterhalb<br />
des Vakuumschwamms, belassen wurde. Während dieser VAC-ON-Phase<br />
erfolgten in der 15. Minute und 30. Minute die Messungen (II) und<br />
(III). Anschließend wurde das Vakuum für 60 Minuten ausgeschaltet. In<br />
dieser VAC-OFF-Phase erfolgten die 15 (IV), 30 (V) und 60 (VI) Minuten<br />
Messungen. Abschließend wurde erneut eine VAC-ON-Phase angeschlossen,<br />
wobei diese 5 Minuten dauerte. Während dieser Zeit erfolgte<br />
schließlich die letzte Messung (VII).<br />
Ergebnisse: Die Auswertung der bisherigen Messergebnisse zeigt, dass insbesondere<br />
der Parameter C, d.h. die Blutflussrate durch die Unterdruckvakuumtherapie<br />
um ein Vielfaches im Vergleich zur Baseline gesteigert<br />
wird. Die Sauerstoffsättigung (A) und die post-kapilläre venöse Füllung<br />
(B) zeigen ebenfalls Veränderungen gegenüber der Baseline, jedoch deutlich<br />
geringer als der Parameter (C), die Blutflussrate.<br />
Fazit: Bei der Beurteilung dieser Zwischenergebnisse lässt sich feststellen,<br />
dass die Blutflussrate von Gewebe durch die Unterdruckvakuumtherapie<br />
deutlich erhöht wird. Durch diese Steigerung der Blutflussrate wird die<br />
Perfusion von Gewebe positiv beeinflusst. Dies könnte einer der Gründe<br />
sein, weshalb die Unterdruckvakuumtherapie einen positiven Effekt<br />
auf die Wundheilung bzw. Wundgrundkonditionierung von chronischen<br />
und traumatischen Wunden hat.<br />
Plastische Chirurgie 10 (Suppl. 1): 53 (<strong>2010</strong>)<br />
Verbrennung/Narbe 2<br />
Freitag, 14:30–16:00, Saal 5<br />
V134 L Darmschrankenstörungen bei<br />
schwerverbrannten Patienten<br />
Abstracts<br />
Thamm OC1 , Spanholtz TA1 , de Haan JJ3 , Lubbers T3 , Buurman WA3 , Neugebauer EAM2 1 2 3 Klinikum Köln-Merheim, Universität Witten/Herdecke; IFOM, Universität Witten/Herdecke; Universitätsklinikum<br />
Maastricht, Niederlande<br />
Die Funktion der Darmschranke ist abhängig von der Perfusion der<br />
Epithelschicht des Intestinums. Verschiedene Untersuchungen erbrachten<br />
Hinweise auf eine Minderperfusion des Epithels mit konsekutiver<br />
Schrankenstörung der Darmfunktion bei polytraumatisierten Patienten.<br />
Auch bei orthopädischen Eingriffen mit großem Blutverlust ließen sich<br />
diese Effekte nachweisen. Die Barrierefunktionsstörung führte zu einer<br />
gesteigerten Morbidität und Mortalität der untersuchten Patienten. Im<br />
Rahmen der Verbrennungskrankheit kommt es im Körper ebenfalls zu<br />
großen Volumenverschiebungen mit Perfusionsstörungen in den Endstromgebieten.<br />
Hypothese: Schwere Verbrennungen führen zu Funktionsstörungen der<br />
Darmschranke.<br />
Methoden: Im Rahmen einer prospektiven Beobachtungsstudie wurden<br />
Patienten mit Verbrennungen untersucht, die eine Aufnahme auf die<br />
Schwerverbranntenintensivstation notwendig machten. Zu definierten<br />
Zeitintervallen (3 h, 6 h, 9 h, 12 h, 1 d, 3 d, 5 d und 7 d) nach Verbrennungstrauma<br />
wurden die Serum-Spiegel zweier Proteine (Intestinal<br />
Fatty Acid Binding Protein (i-FABP) und Ileal-Bile Acid Binding Protein<br />
(i-BABP)) bestimmt, die spezifisch nur von den Enterozyten gebildet<br />
werden und somit direkt den Grad der Zellschädigung abbilden. Diese<br />
Daten wurden mit der Größe der Verbrennung (% KOF) korreliert. Außerdem<br />
wurden zu jedem Zeitpunkt diverse Vitalparamter erfasst, die<br />
den Gesundheitszustand des Patienten widerspiegelten.<br />
Ergebnisse: Im Untersuchungszeitraum wurden n=15 Patienten inkludiert,<br />
deren Verbrennungsausmaß eine intensivmedizinische Betreuung<br />
notwendig machte. Im zeitlichen Verlauf zeigten alle Patienten einen signifikanten<br />
Anstieg der untersuchten Proteine. Nach 3 Tagen kam es<br />
zu einem deutlichen Abfall der Spiegel, und an Tag 5–7 wurden wieder<br />
Normalwerte erreicht. Die Größe der Verbrennung korrelierte hierbei<br />
mit dem Ausmaß der Zellschädigung.<br />
Fazit: Die Verbrennungskrankheit führt aufgrund der rasch einsetzenden<br />
Volumenverschiebung zu einer nachweisbaren Schädigung des Darmepithels<br />
mit konsekutiver Darmschrankenstörung. Dieser Effekt scheint<br />
vom Ausmaß der Verbrennung abhängig zu sein. Die untersuchten Patientenzahlen<br />
sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch zu klein, um eine<br />
klare Korrelation sicher angeben zu können und therapeutische Empfehlungen<br />
abzuleiten. Eine größere Fallzahl ist notwendig.<br />
V135 L Intensivierte Insulintherapie bei schwerverbrannten<br />
Patienten – Einfluss auf Mortalität und Morbidität<br />
in einer Matched-pair-Analyse<br />
Spanholtz TA, von Cramon L, Theodorou P, Perbix W, Spilker G<br />
Klinikum Köln-Merheim, Universität Witten/Herdecke<br />
Hochrangige Publikationen der letzten Jahre spiegeln ein widersprüchliches<br />
Bild über den Vorteil einer intensivierten Insulintherapie (IIT) in<br />
der Gruppe intensivmedizinischer Patienten wider. In der Subkohorte<br />
der schwerverbrannten Patienten stehen in diesem Zusammenhang nur<br />
limitiert Daten zur Verfügung.<br />
53