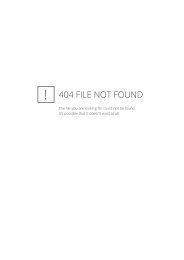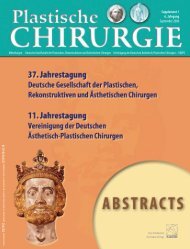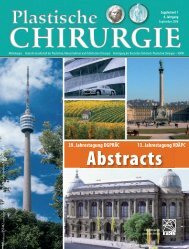Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Poster | Freitag | 17.9.<strong>2010</strong><br />
P94 L Phlegmonöse Entzündung nach Octenisept®spülung<br />
einer Hämatomhöhle nach Abdominoplastik bei<br />
einer 45jährigen Patientin<br />
Boorboor P, Allert S<br />
Kreiskrankenhaus Hameln<br />
Hypothese: Octenidin(-dihydrochlorid) ist ein oberflächenaktiver Wirkstoff,<br />
der für die Antiseptik in Kombination mit 2 % Phenoxyethanol<br />
unter dem Handelsnamen Octenisept® eingesetzt wird. Das Wirkungsspektrum<br />
umfasst grampositive und gramnegative Bakterien, Pilze sowie<br />
eine Reihe von Virusarten. Nach den vom Hersteller vorgegebenen Anwendungshinweisen<br />
sollte dieses Antiseptikum nicht unter Druck ins<br />
Gewebe eingebracht werden, bzw. jederzeit ein Abfluss gewährleistet<br />
sein. In letzter Zeit häufen sich Berichte und Schlichtungsverfahren über<br />
phlegmonöse Reaktionen auf Octenisept nach septischen Operationen.<br />
Methoden: Wir berichten über eine 45jährige Patientin, die eine phlegmonöse<br />
Entzündung nach Octenisept-Spülung entwickelte. Nach einer Abdominoplastik<br />
kam es bei dieser Patientin zu einem subkutanen Hämatom<br />
im linken Unterbauch. Eine Schwellung, ein lokaler Druckschmerz<br />
und leicht erhöhte Infektwerte deuteten auf eine beginnende Infektion.<br />
Ansonsten bot sie keine weiteren lokalen oder systemischen Infektzeichen.<br />
Nach der ambulanten Ausräumung des Hämatoms erfolgte eine<br />
Spülung der Hämatomhöhle mit Octenisept. Die Lösung wurde ohne<br />
Druck in die Wunde eingebracht. Danach wurde die Höhle mit NaCl-<br />
Lösung ausgespült und eine Lasche zwecks Drainage eingelegt. 3 Tage<br />
nach diesem Vorgehen entwickelte die Patientin eine lang anhaltende<br />
und phlegmonöse Entzündungsreaktion mit deutlichen systemischen<br />
Infektzeichen. Weder bakteriologische, noch histologische Analysen<br />
zeigten Hinweise auf eine mikrobielle Infektion. Ebenso wurde eine allergische<br />
Reaktion auf Octenisept ausgeschlossen. Eine CT-Abdomen-<br />
Untersuchung konnte keinen Zusammenhang mit angrenzenden anatomischen<br />
Einheiten, insbesondere dem Peritoneum und Bauchorganen,<br />
aufzeigen.<br />
Ergebnisse: Bettruhe, eine Vaccum-Behandlung und eine Medikation mit<br />
systemischen Antibiotika und nichtsteroidalen Antirheumatika führten<br />
nach 3 Wochen zum allmählichen Rückgang der Infektzeichen. Als Residuum<br />
blieb eine subkutane Fibrose, welche als Strang im ehemaligen<br />
Phlegmone-Gebiet tastbar ist, die Ästhetik beeinflusst und somit einer<br />
Korrektur bedarf.<br />
Fazit: Bis jetzt sind in der Literatur phlegmonöse Reaktionen auf Octenisept<br />
nur bei Kindern beschrieben. Angesichts des beschriebnen Falles<br />
und einigen laufenden und abgeschlossenen Schlichtungsverfahren sind<br />
ähnliche Reaktionen bei Erwachsenen, auch bei Einhaltung der Herstellervorgaben,<br />
nicht ausgeschlossen. Octenisept scheint bei Verbleiben<br />
in tiefen Wunden durch den langsamen Abbau eine irritativ-toxische<br />
Wirkung zu entwickeln. Tiefe, kontaminierte Wunden sollten deshalb<br />
vorrangig debridiert werden und angesichts der Komplikationshäufung<br />
nicht mit Octenisept gespült werden.<br />
Plastische Chirurgie 10 (Suppl. 1): 107 (<strong>2010</strong>)<br />
P95 L bariatrische Chirurgie mit dem<br />
Patientenhebekran Golvo<br />
Maier M, Redeker J, Schönborn A, Hankiss J<br />
Klinikum Lippe-Lemgo<br />
Abstracts<br />
Wir demonstrieren den Fall eines 62jährigen Patienten mit krankhafter<br />
Esssucht (Bing Eating Disorder) nach operativer Therapie eines Hypophysenadenoms,<br />
der innerhalb von 4 Jahren sein Gewicht von ca. 85 kg<br />
(BMI 29,4) auf 174 kg (BMI 60,2) steigerte. Aufgrund des progredienten<br />
Verlaufes mit entgleistem Diabetes mellitus Typ IIb und kardiopulmonaler<br />
Dekompensation, der Unmöglichkeit einer Bewegungstherapie aufgrund<br />
einer bis über die Knie hängendenden abdominellen Fettschürze<br />
sowie der Compliance-bedingten Kontraindikation zur viszeralchirurgischen<br />
Adipositaschirurgie entschieden wir uns mangels Alternativen<br />
zur primären Fettschürzenamputation. Aufgrund des Gewichtes der<br />
Fettschürze von 29 kg war der intraoperative Einsatz eines Patientenhebegerätes<br />
Golvo der Firma Liko erforderlich. Die Aufhängung der Fettschürze<br />
wurde mit Mandrins von Thoraxdrainagen der Größe Charr.<br />
28 durchgeführt. Die Schnitt-Naht-Zeit betrug 140 min. Nach 9 Tagen<br />
entwickelten sich eine MRSA-Wundinfektion mit Sekretion von Pus<br />
und Dehiszenz. In der Folge kam es zum einem Aufreißen der abdominellen<br />
Operationswunde über die gesamte Länge. Außerdem entwickelte<br />
der Patient am 41. postoperativen Tage einen linkshirnseitigen Apoplex.<br />
Nach 2 Tagen offener Wundtherapie mit Spülungen erfolgte die Revision<br />
mit Sekundärnaht. Die sekundär genähte Wunde heilte schließlich ab,<br />
die Verweildauer betrug 47 Tage. Die Symptome des Apoplexes waren<br />
innerhalb von mehreren Monaten fast vollständig rückläufig. Durch eine<br />
intensive Nachbetreuung und jetzt mögliche Bewegungstherapie konnte<br />
das Gewicht von 144 kg (BMI 49,8) postoperativ auf 103 kg (BMI 35,6)<br />
innerhalb von 2 Jahren gesenkt werden. Unsere Patienten mit Adipositas<br />
per magna durchlaufen in unserem interdisziplinären Adipositaszentrum<br />
in der Regel ein umfangreiches Programm zur Gewichtsreduktion<br />
unter ständiger Betreuung von Ernährungsmediziner und Diätassistenten,<br />
Bewegungstherapie in einem speziell ausgestatteten Fitness-Studio,<br />
regelmäßigen Schulungen und psychotherapeutischer Unterstützung.<br />
Bei Bedarf stehen alle viszeralchirurgischen Operationsverfahren zur<br />
operativen Unterstützung der Gewichtsreduktion zur Verfügung. Nach<br />
erfolgreicher massiver Gewichtsreduktion steht dann die plastisch-chirurgische<br />
Korrektur der Körperkonturen in der zeitlichen Reihenfolge<br />
zu Recht an letzter Stelle. In Ausnahmefällen muss wie in unserem Fall<br />
von diesem Standardverfahren allerdings bewusst abgewichen werden.<br />
107