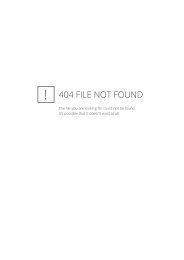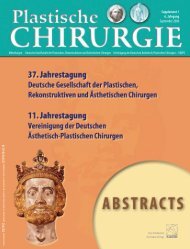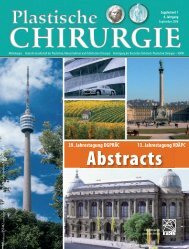Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Abstracts<br />
P53 L Organisation eines multidisziplinären<br />
Narbenzentrums<br />
Hierner R<br />
Universitätsklinikum Essen<br />
Die Behandlung posttraumatischer und elektiver Narben sowie Schwellungszusände<br />
nimmt heute an Bedeutung zu.<br />
Patienten und Methode: Seit 5/2004 besteht an unserer Klinik eine multidisziplinäre<br />
Narbensprechstunde. Im Zeitraum von 1.1.2005–31.12.2005<br />
haben wir 700 Patienten behandelt. Mitglieder unserer multidisziplinären<br />
Sprechstunde sind neben dem Patienten und dessen Familie/Angehörige,<br />
Pflegepersonal, Medizin technisches Personal (Diätassistent,<br />
Orthopädiemeister) ärztliches Personal (Dermatologie, Plastische Chirurgie,<br />
Strahlentherapie ...), Krankenkassen und gegebenenfalls fakultative<br />
Mitglieder. Je besser die einzelnen Mitglieder des Therapie Teams<br />
zusammenarbeiten, desto besser ist das Ergebnis. Der stetige Informationsaustausch<br />
innerhalb des Therapie-Teams durch Arztbriefe, Emails<br />
und/oder Telefonate ist von zentraler Bedeutung. Für eine erfolgreiche<br />
Zusammenarbeit der Mitglieder des Therapieteams benötigt man eine<br />
„gemeinsame Sprache”. Für die Diagnostik und Dokumentation verwenden<br />
wir ein standardisiertes Diagnostik- und Dokumentationsschema<br />
„Narbe“ (Scar evaluation System/SES). Zur Diagnostik gehören Erhebung/Aktualisierung<br />
der Kenndaten, Allgemeinanamnese (einmalig),<br />
Erhebung des aktuellen extrinsischen und intrinsischen Risikoprofils<br />
(Patienten-bedingte Faktoren), klinische Untersuchungen und gezielte<br />
unterstützende apparative Untersuchungen zur Klassifikation der Narbe<br />
(Defekt-bedingte Faktoren). Das SES ist die Basis für die Erarbeitung<br />
verschiedener „clinical pathways“ („Narbenprävention“, „Narbensupression“,<br />
„Narbenkorrektur“). Für die Therapie von „inadäquaten Narben“<br />
verwenden wir ein sogennantes „integratives Therapiekonzept“,<br />
welches neben Prävention, Suppression und Korrektur von Narben eine<br />
intensive Basishauttherapie und eventuelle adjuvante Maßnahmen umfasst.<br />
Neben der Prävention (elektive Schnittführung, Nahttechniken)<br />
kommt der strukturierten postoperativen Narbentherapie die größte<br />
Bedeutung zu. Die Prinzipien der Behandlung elektiver Narben entsprechen<br />
jenen der Behandlung von Verbrennungsverletzungen. Eine<br />
adäquate Hautbasispflege, Narbenmassage und ein früher Einsatz von<br />
Silikon alleine oder in Verbindung mit Drucktherapie stellen die Grundpfeiler<br />
der Therapie dar.<br />
Ergebnisse: Mithilfe eines globalen multidisziplinären Behandlungskonzeptes,<br />
welches 6–12 Monate post operationem durchgeführt werden<br />
muss, ist es möglich deutlich bessere ästhetische und (funktionelle) Ergebnisse<br />
zu erzielen.<br />
Fazit: Durch die multidisziplinäre Behandlung von Narben und die Verteilung<br />
des flow-sheats hat sich die Aufmerksamkeit bezüglich einer<br />
verbesserten Narbenheilung an unserer Klinik deutlich erhöht. Neben<br />
der Prävention (elektive Schnittführung, Nahttechniken) kommt der<br />
strukturierten postoperativen Narbentherapie die größte Bedeutung zu.<br />
Durch konsequente Drucktherapie kann eine hypertrophe Narbenbildung<br />
deutlich vermindert werden<br />
P54 L Mögliche Rekonstruktionen nach Resektion eines<br />
Angiosarkoms am Kopf – Fallbeispiel<br />
Reba S, Schramm S, Maier M, Kreutzheide J, Hankiss J<br />
Klinikum Lippe-Lemgo<br />
Poster | Freitag | 17.9.<strong>2010</strong><br />
Die Angiosarkome (AS) sind hochmaligne Tumore die von den Endothelzellen<br />
ausgehen und gehören zu den selten Formen der Weichteilsarkome.<br />
Das Durchschnittsalter der Erstdiagnose des Angiosarkoms<br />
liegt bei 65 bis 70 Jahren und wird häufiger bei Männern als bei Frauen<br />
festgestellt. Von der Lokalisation sind am meisten die oberflächlichen<br />
Weichteile und die Haut betroffen, insbesondere im Kopf-Hals-Bereich.<br />
Einteilung: Das idiopathische kutane AS ohne Lymphödem, das Lymphödem-assoziierte<br />
AS, AS der Brust, AS nach Radiatio, AS der tiefen<br />
Weichteile.<br />
Diagnostik: Klinische Untersuchung (blaurote Knoten, Blutungen,<br />
Schwellungen im Gesichtsbereich) und histologischer Nachweis.<br />
Therapie: Rechtzeitige und großzügige Resektion. Im Anschluss ist die<br />
Radiatio zu empfehlen mit palliativer Chemotherapie (antiangiogenetisches<br />
Targeting).<br />
Prognose: Sehr schlecht aufgrund des diffus-infiltrativen,diskontinuier<br />
lichen bis multifokalen Wachstums. Die 5-Jahres-Überlebensrate: 12–<br />
24 %, Median: 18–28 Monate.<br />
Methoden/Ergebnisse: Im Mai 2008 erfolgte bei einem 72jährigen Patienten<br />
eine primäre Resektion eines Hauttumors am Kopf durch die Kollegen<br />
aus der Dermatologischen Klinik mit V.a. Melanom. Es folgten 2<br />
Nachexzisionen bei histologisch gesicherten Angiosarkom. Nach dem<br />
die Resektion „im Gesunden“ histologisch bestätigt wurde, erfolgte ein<br />
Anbohren der Schädelkalotte zur Granulation, Zwecks Defektdeckung<br />
durch Spalthaut. Da keine ausreichende Granulation zu erzielen war,<br />
wurde uns der Patient erstmalig im Juli 2009 vorgestellt: 1) Der Defekt<br />
wurde mit eine freiem Latissimus dorsi Lappen (mikrochirurgischem<br />
Anschluss an die A. temporalis rechts) und Spalthauttransplantation<br />
auf den transplantierten Muskel gedeckt. Es kam zum postop. Hämatom<br />
bei diffuser Nachblutung und in Folge partielle Nekrose des freien<br />
Lat.-dorsi-Lappens. 2) Erneute Defektdeckung mit ALT-Lappenplastik<br />
von li. Oberschenkel. Strahlentherapie. 3) Am 2.3.2009 Nachresektion<br />
wg. Rezidiv eines AS an der Stirn, hier erfolgte am 13.3.2009 eine<br />
Nachresektion und die Defektdeckung durch ALT-Lappenplastik vom<br />
re. OS. In den regelmäßigen Kontrollen von März bis Sept. zeigten sich<br />
keine Auffälligen Befunde. Im Oktober 2009 wurde wg. V.a. AS-Rezidiv<br />
am Kopf links-parietal,ein MRT des Kopfes durchgeführt, welche keinen<br />
sicheren Nachweis für ein Rezidiv ergab. Es wurden kurzfristige<br />
Verlaufskontrollen durchgeführt. Am 17.12.<strong>2010</strong> konnte eine deutliche<br />
Zunahme der lividen Schwellung an der lat. Augenbraue links, in den<br />
Orbitarand auslaufend, festgestellt werden. Die MRT mit Gefäßdarstellung<br />
zeigte diesmal einen hochgradigen V.a. Rezidiv eines AS. 4) Es folgten<br />
insgesamt 4 weitere Operationen zur Resektion des AS. Am 1.3.<strong>2010</strong><br />
Deckung mit freien lat. Oberarmlappenplastik. Lange Zeitintervalle ergaben<br />
sich dadurch dass die Pathologen die Präparate zur Befundbestätigung<br />
in ein zweites Institut für Pathologie weitergeleitet hatten. Zurzeit<br />
erhält der Patient Chemotherapie sowie engmaschige Befundkontrollen.<br />
Fazit: Die AS sind hochmaligne Tumore die rechtzeitig und großzügig<br />
reseziert werden sollten.Bei freiliegender Schädelkalotte sollten die großen<br />
Weichteildefekte durch freie Lappenplastik(-en) gedeckt werden. In<br />
so einer Konstellation ist die adäquate Chirurgische Versorgung des Pat.<br />
am ehesten in einer Abteilung für Plastische Chirurgie gegeben. Im Anschluss<br />
an die Operation sollte die Radiatio und palliative Chemotherapie<br />
erfolgen, sowie Staging Untersuchungen wie Rö-Thorax, Abdomen-<br />
Sono und MRT/CT.<br />
92 Plastische Chirurgie 10 (Suppl. 1): 92 (<strong>2010</strong>)