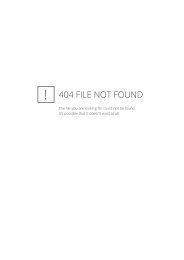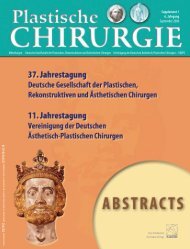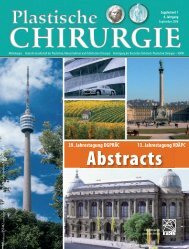Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Poster | Freitag | 17.9.<strong>2010</strong><br />
subscapularis, teres major et minor und infraspinatus bildet, den Bronchusstumpf<br />
verschließen und die Pleurahöhle obliterieren kann.<br />
Patienten und Methode: In der Zeitspanne 2002–2007 wurde die Technik<br />
bei 6 Patienten mit einem chronischen, postoperativen Pleuraempyem<br />
und broncho-pleuraler Fistel angewandt. 3 Patienten hatten ein post-<br />
TBC-Syndrom, 2 Patienten ein Postpneumektomie-Empyem und 1 Patient<br />
hatte ein parapneumonisches Empyem. In allen Fällen wurde durch<br />
die Kollegen der Thoraxchirurgie primär ein Thoraxfenster angelegt und<br />
die Empyemhöhle über 3 Monate offen behandelt. Im Rahmen der lokalen<br />
Thorakoplastik wurden im Durchschnitt 5±2 Rippen reseziert.<br />
Dieser Resektion folgte die Myoplastik mittels M. infraspinatus, teres<br />
major et minor und subscapularis. Der subscapularis wurde hierbei zum<br />
Verschluss der Bronchusfistel genutzt.<br />
Ergebnisse: Alle Patienten waren Männer, das mittlere Alter betrug<br />
68±5,7 Jahre. Die Morbiditäts- und Letalitätsraten lagen bei 25 % und<br />
0 %. Die postoperativen Komplikationen wurden in erster Linie durch<br />
respiratorische Insuffizienz infolge der Atelektasenbildung, Pneumonie<br />
sowie eine Nachblutung bedingt. Der stationäre Aufenthalt dauerte<br />
15±7,6 Tage. Postoperativ wurden keine Empyemrezidive beobachtet.<br />
Ein Patient ist infolge eines sekundären Tumorleidens verstorben. Die<br />
Einschränkungen der Schulterfunktion waren mit einem Abduktionsdefizit<br />
von 15±10 Grad nur gering.<br />
Diskussion: Die Techniken der Thorakoplastik sind vielfältig. Die im<br />
Rahmen der posterolateralen Thorakotomie durchtrennten Muskeln<br />
(latissimus, serratus) sind nur bedingt zur Myoplastik verwendbar. Die<br />
Schultergürtelmuskulatur stellt unter Erhalt der Funktionalität im betroffenen<br />
Schultergelenk eine sinnvolle Ergänzung zur konventionellen<br />
Myoplastik mit gleichzeitigem Verschluss der Bronchusfistel dar.<br />
P61 L Prognosefaktoren und chirurgische sanierbarkeit<br />
einer sternumosteomyelitis nach kardiochirurgischen<br />
Eingriffen<br />
Hellmich S, Kolbenschlag J, Lehnhardt M, Megerle K<br />
BG-Unfallklinik Ludwigshafen<br />
Die Entwicklung einer Sternumosteomyelitis oder einer sternalen<br />
Wundheilungsstörung nach kardio-chirurgischen Eingriffen ist mit einer<br />
Inzidenz von 1 bis 4 % insgesamt eine seltene Komplikation mit hoher<br />
Mortalität. Das Patientenprofil stellt aufgrund der Grunderkrankungen<br />
sowie der manifesten Infektion (häufig mit Problemkeimen) in unmittelbarer<br />
topographischer Beziehung zu Pleura und Perikard eine besondere<br />
Herausforderung dar. Ziel dieser Arbeit war es, Prognosefaktoren für<br />
die chirurgische Sanierbarkeit dieser Problemwunden zu identifizieren.<br />
Material und Methoden: In den Jahren 2000 bis 2008 wurden uns 98 Patienten<br />
(39 Frauen; 59 Männer) zur Thoraxwandrekonstruktion nach<br />
kardio-chirurgischen Eingriffen vorgestellt, im Mittel 50 Tage nach dem<br />
Primäreingriff. Dieser war bei 80 Patienten ein Gefäßersatz bei KHK sowie<br />
Klappenersatz bei 18 Patienten. Das durchschnittliche Alter betrug<br />
67 (31–86) Jahre, dabei stieg der Altersdurchschnitt von 62 Jahren im<br />
Jahr 2000 auf über 70 Jahre in den Jahren 2007 und 2008. Der postoperative<br />
Verlauf wurde bei 89 Patienten nach einer mittleren Nachbeobachtungsdauer<br />
von 48 Monaten analysiert.<br />
Ergebnisse: Wir führten in 63 Fällen eine gestielte und in 26 Fällen eine<br />
freie Lappenplastik zur Defektdeckung durch. Die Durchführung eines<br />
freien Gewebetransfers unterlag einer strengen Indikationsstellung.<br />
32 Patienten verstarben durchschnittlich 69 Wochen nach Entlassung<br />
bzw. Verlegung aus unserer Klinik, davon zwei Drittel (21) innerhalb<br />
des ersten Jahres nach plastischer Deckung. Trotz des komplexen Rekonstruktionsverfahrens<br />
betrug die perioperative Mortalität in unserer<br />
Abteilung nur 6 % (5/89). Bei 80 Prozent der überlebenden Patienten<br />
Plastische Chirurgie 10 (Suppl. 1): 95 (<strong>2010</strong>)<br />
Abstracts<br />
konnte ein dauerhafter Verschluss der Thoraxwand erreicht werden.<br />
Die untersuchten nicht kardialen Nebendiagnosen standen in keinem<br />
statistisch signifikanten Zusammenhang mit dem Überleben der Patienten<br />
oder dem Erfolg der plastischen Deckung. Eine fehlende chirurgische<br />
Sanierbarkeit der Weichteile wie bei länger freiliegendem Perikard<br />
oder exponierter Pleura war mit einer erhöhten Mortalität assoziiert.<br />
Fazit: Mit den plastischen Rekonstruktionsmöglichkeiten gelingt es oft,<br />
die chronische Osteomyelitis zur Ausheilung zu bringen. Dennoch sind<br />
die Eingriffe auch nach primär erfolgreicher Lappendeckung mit einer<br />
hohen Mortalität assoziiert. Die Identifikation weiterer Prognosefaktoren<br />
ist notwendig um die Selektion der Patienten zu verbessern, die von<br />
einer plastischen Deckung profitieren.<br />
P62 L sternumrekonstruktion: Zwei erfolgreiche<br />
techniken mit ersten Langzeitergebnissen<br />
Sultan M, Hidayat M, Nerlich M, Gehmert S, Prantl L<br />
Universitätsklinikum Regensburg<br />
Die Sternotomie stellt eine der häufigsten Zugänge bei Operationen am<br />
offenen Herzen da. Postoperative Infektionen des Sternums bedingen<br />
häufig eine partielle oder komplette Resektion, in deren Folge es zu einer<br />
Instabilität der vorderen Thoraxwand kommt.<br />
Hypothese: Um eine gute Stabilität der vorderen Thoraxwand nach Sternumresektion<br />
zu erreichen, kann ein osteokutaner Paraskapularlappen<br />
oder/und eine transversale, winkelstabile Plattenosteosynthese in Abhängigkeit<br />
der Defektgröße verwendet werden.<br />
Methoden: Wir behandelten 6 Patienten bei partieller oder kompletter<br />
Sternumresektion nach Osteomyelitis mit a) einer winkelstabilen Plattenosteosynthese<br />
die im Bereich der Rippen verankert wurde (n=3)<br />
oder/und b) einem osteokutanen Paraskapular-Lappen (n=3). Mittels<br />
dynamischer, kontrastverstärkter Sonographie wurde die Perfusion der<br />
Lappenplastiken im zeitlichen Verlauf beobachtet. Außerdem wurde die<br />
Computertomographie (CT) eingesetzt, um die Stabilität der voderen<br />
Thoraxwand beurteilen zu können (i.e. Lockerungzeichen der Plattenosteosynthese,<br />
Einheilung des vaskularisierten Knochenspans). Die<br />
Patienten wurden über einen Zeitraum von 3 Jahren nach erfolgreicher<br />
Operation beobachtet.<br />
Ergebnisse: Postoperativ konnte eine Stabilisierung der vorderen Thoraxwand<br />
in allen 6 Patienten erreicht werden, jedoch verstarb ein Patient<br />
im Rahmen seiner kardialen Grunderkrankung. In der dynamisch, kontrastverstärkten<br />
Sonographie fanden sich regelrechte Gefäßverhältnisse<br />
in den 3 osteokutanen Lappenplastiken. Im CT zeigten sich keine Lockerungen<br />
des Osteosynthesematerials, sowie eine regelrechte Einheilung<br />
der ossären Späne ohne Zeichen einer Knochenresorption.<br />
Fazit: Die transversale, winkelstabile Plattenosteosynthese bietet eine<br />
einfache Stabilisierung des Thorax bei partieller Sternumresektion mit<br />
guten Langzeitergebnissen. Bei kompletter Sternumresektion oder größeren<br />
Wunddehiszenzen kann der osteokutane Paraskapularlappen eingesetzt<br />
werden. Dabei ist eine schrittweise Entfernung der fixierenden<br />
osteosynthetischen Materialien ohne Verlust der Thoraxstabilität möglich.<br />
P63 L therapiekonzept der Infektsanierung<br />
bei chronischer sternumosteomyelitis<br />
Stütz N, Lang A, Busch K<br />
Malteser Krankenhaus Bonn<br />
Die Inzidenz der Sternumosteomyelitis nach kardiochirurgischen Eingriffen<br />
wird in der Literatur mit bis zu 1 % angegeben. Hierbei ist die<br />
Sternumosteomyelitis für den Patienten potentiell lebensbedrohlich<br />
95