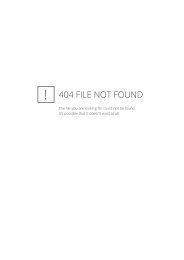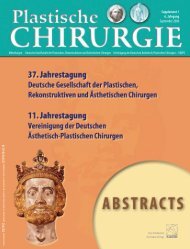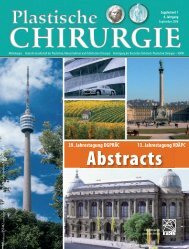Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Poster | Freitag | 17.9.<strong>2010</strong><br />
rung spezieller Muskelgruppen injiziert. In der Folge kann es zu massiven<br />
Komplikationen in Form von Abszessen, Ölzysten und Fremdkörpergranulomen<br />
kommen.<br />
Methoden: In unserer Klinik wurden in der Zeit von März bis <strong>September</strong><br />
2009 zwei Patienten mit Komplikationen nach Ölinjektion vorstellig.<br />
Ergebnisse: Bei dem ersten Fall handelt es sich um einen 38jährigen Patienten,<br />
der sich mit akuten abszedierenden Fremdkörpergranulomen an<br />
beiden Oberarmen vorstellte. Laut Anamnese hat der Patient in früheren<br />
Jahren extensives Krafttraining betrieben und im Rahmen dessen gezielt<br />
muskelschwache „Problemzonen“ mittels intramuskulären Injektionen<br />
von Sesamöl behandelt. Im Verlauf entwickelten sich im Bereich der behandelten<br />
Areale zunehmend Fremdkörpergranulome. Zum Zeitpunkt<br />
der Vorstellung fanden sich bereits perforierte Abszesse am linken Oberarm.<br />
Die Granulome wurden in unserer Klinik operativ entfernt. Bei<br />
dem zweiten Patienten handelt es sich um einen 39jährigen Patienten,<br />
der in der Vergangenheit über 13 Jahre beruflich Bodybuilding betrieben<br />
hat. Der Patient injizierte während seiner Laufbahn verschiedene Produkte,<br />
unter anderem das synthetisch hergestellte Öl Syntol, das zum<br />
gezielten optischen Muskelaufbau auf dem Schwarzmarkt erhältlich ist.<br />
Die Injektionen wurden im Bereich der Arme, insbesondere aber auch<br />
im Bereich der Brust intramuskulär in den M. pectoralis und subcutan<br />
durchgeführt. Im Verlauf bildeten sich massive multiple Fremdkörpergranulome<br />
und Ölzysten, sowie erschwerend nach Beendigung des<br />
Trainings und Verlust der Muskelmasse eine Mammahypertrophie mit<br />
viertgradiger Ptose und Asymmetrie. Bei dem Patienten führten wir eine<br />
Weichteilreduktion und Frendkörperentfernung im Sinne einer Mammareduktionsplastik<br />
mit kaudal gestielten Mamillen durch.<br />
Fazit: Im Rahmen von intramuskulären und subkutanen Injektionen<br />
von synthetischen oder natürlichen Ölen zum Zwecke des optischen<br />
Muskelaufbaus kann es zu schwerwiegenden akuten und chronischen<br />
Komplikationen kommen, die teils aufwändige operative Maßnahmen<br />
erforderlich machen.<br />
P51 L Komplikationen nach Weichteilaugmentation mit<br />
flüssigem silikon und Polyacrylamid-Hydrogel<br />
Kernt B, Kunzelmann M, Deiler S<br />
Universitätsklinikum München Innenstadt<br />
Die Anwendung von Polyacrylamid-Hydrogel und flüssigem Silikon als<br />
Fillermaterial kann zu schwerwiegenden Komplikationen wie Infektionen,<br />
Abszessbildungen, Fremdköpergranulomen und Fettgewebsnekrosen<br />
führen. Die vollständige Entfernung dieser Materialien geht in<br />
den meisten Fällen mit einem Formverlust der betroffenen Körperregion<br />
einher. Wir stellen den Fall einer 32jährigen Patientin vor, bei der die<br />
wiederholte Injektion von flüssigen Silikon und Polyacrylamid-Hydrogel<br />
zur Konturierung des Gesäßbereiches zu multiplen schmerzhaften<br />
subkutanen Granulomen und Fettgewebsnekrosen geführt hatte. Diese<br />
konnten nur durch mehrfache Interventionen entfernt werden und so<br />
ein akzeptables funktionelles Ergebnis erzielt werden.<br />
Methodik: Fallbericht; chirurgische Entfernung des Fremdmaterials in<br />
mehreren operativen Schritten: Liposuction, radikale Geweberesektion<br />
bis auf die Glutealmuskulatur, V.A.C.®-Therapie und Jet-Lavage. Befunddokumentation<br />
mittels MRT, intraoperativer Endoskopie zur detaillierten<br />
Darstellung der Fillermaterialien in situ, Fotodokumentation, Bakteriologie<br />
und Histopathologie.<br />
Ergebnisse: Nur durch eine radikale chirurgische Entfernung der Fillermaterialien<br />
in mehreren Operationen konnte Beschwerdefreiheit erreicht<br />
werden. Intraoperativ zeigte sich lipolytisches Gewebe mit in Bin-<br />
Plastische Chirurgie 10 (Suppl. 1): 91 (<strong>2010</strong>)<br />
Abstracts<br />
degwebe eingemauerten Fremdköpern. Die histologische Begutachtung<br />
zeigte Silikon-Granulome und Fremdkörper-Riesenzellen. Es ergab sich<br />
kein Hinweis auf Infektion. Aufgrund der multiplen Eingriffe und der<br />
schwierigen Ausgangssituation konnte nur ein befriedigendes ästhetisches<br />
Ergebnis erzielt werden.<br />
Fazit: Dieser Fallbericht zeigt, dass flüssiges Silikon und Polyacrylamid als<br />
Fillermaterialien zu schwerwiegenden Komplikationen führen können.<br />
Nur durch mehrere operative Interventionen und vollständiger Entfernung<br />
der Fillersubstanzen konnte bei der Patientin Beschwerdefreiheit<br />
erzielt werden. Zur Formkorrektur der Gesäßregion werden weitere Eingriffe<br />
notwendig sein.<br />
P52 L Photomorphometrische Evaluation der<br />
abdominalen Narbenposition nach brustrekonstruktion<br />
mittels tRAM/DIEP und Erhebung der Zufriedenheit<br />
mittels befragung<br />
Penna V, Iblher N, Torio-Padron N, Stark GB<br />
Universitätsklinikum Freiburg<br />
Die Verwendung von abdominalem Eigengewebe (TRAM/DIEP) zur<br />
Rekonstruktion der Brust nach Ablatio mammae ist ein immer häufiger<br />
durchgeführtes plastisch-chirurgisches Verfahren. Hier ist neben<br />
dem ästhetischen Anspruch an die Brustformung auch immer mehr die<br />
Ästhetik und Positionierung der abdominalen Narbe wesentlich für die<br />
Patientinnen.<br />
Hypothese: In der vorgestellten Arbeit wurde zum einen die Narbenpositionierung<br />
abdominal evaluiert und die Zufriedenheit der Patientinnen<br />
mit der Narbe erfragt.<br />
Methode: In der vorliegenden Studie wurden postoperative Bauchaufnahmen<br />
von 50 konsekutiv durchgeführten TRAM/DIEP-Lappen bezüglich<br />
der Positionierung der Narbe standardisiert photomorphometrisch nachuntersucht.<br />
Mithilfe von Adobe Photoshop® wurde zwischen beiden Spinae<br />
iliacae anteriores superiores eine Linie gezogen. Ebenfalls wurde<br />
parallel hierzu in Höhe des Perineums eine horizontale Linie gezogen.<br />
Der Abstand zwischen beiden Linien wurde als 100 % definiert und die<br />
Position der Narbe im Skalierungsbereich ermittelt. Zusätzlich erfolgte<br />
eine Befragung der Patientinnen bezüglich Zufriedenheit mit der Narbe<br />
und der Narbenpositionierung. Ebenso wurde erfragt, ob die Bauchnarbe<br />
beim Tragen von normalen Unterhosen versteckt ist und wie wichtig<br />
den Patientinnen eine versteckte Bauchnarbe ist.<br />
Ergebnisse: Die mittlere Narbenposition lag bei einem Wert von 16,66 %<br />
(±10,36). Zwei Patientinnen hatten Narben, die über die Linie zwischen<br />
beiden Spinae gingen (Werte: –8 %, –4 %). 8 von 50 Patientinnen<br />
waren mit der Narbe aufgrund Breite und Pigmentierung unzufrieden.<br />
Lediglich 2 Patientinnen waren mit der Narbenpositionierung unzufrieden,<br />
hier war die Narbe auch nicht von der Unterhose bedeckt. Die<br />
Frage, wie wichtig es sei, dass die Narbe versteckt ist, beantworteten<br />
30 % mit sehr wichtig, 35 % mit wichtig und 35 % mit neutral. Keine<br />
der Patientin gab an, dass die nicht verdeckte Narbe wenig wichtig oder<br />
unwichtig sei.<br />
Fazit: Neben einer ästhetisch anspruchsvollen Formung der Brust ist<br />
die tiefe Positionierung der Entnahmenarbe unterhalb der Spinae und<br />
innerhalb der sogenannten Bikinizone entscheidend für die Lebensqualität<br />
und das Wohlbefinden der Patientinnen nach Brustkrebs und<br />
Brustaufbau durch Eigengewebe.<br />
91