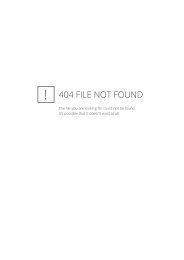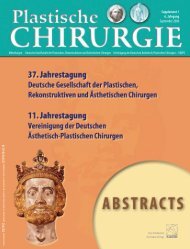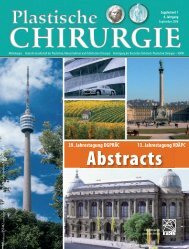Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Abstracts<br />
P24 L Intravitale Analyse der vaskulären und<br />
inflammatorischen Reaktion auf gasplasmamodifizierte<br />
allogene Knochenersatzmaterialien<br />
Hauser J, Schaffran A, Ring A, Steinau H-U, Henrich L, Langer S<br />
BG-Universitätsklinikum Bergmannsheil Bochum<br />
Knochenersatzmaterialien finden ihren Einsatz in der Behandlung von<br />
Knochendefekten verschiedenster Genese. Für die Funktionalität und<br />
den Erhalt der Knochenersatzmaterialien ist die schnelle Ausbildung eines<br />
adäquaten stabilen Gefäßnetzes von entscheidender Bedeutung. Die<br />
vaskulären und inflammatorischen Reaktionen auf einen Gasplasmamodifizierten<br />
allogenen Knochenersatz wurden in-vivo analysiert.<br />
Material und Methoden: Die Untersuchungen wurden mittels intravitaler<br />
Fluoreszenzmikroskopie anhand des Models der dorsalen Rückenhautkammer<br />
der Maus (n=20) durchgeführt. Als Implantatmaterial dienten<br />
dreidimensionale, standardisierte Proben eines allogenen Knochenersatzes<br />
(dehydrierter humaner Femurkopf, Tutoplast®). Diese wurden<br />
nach zweiminütiger Behandlung in einem doppelt-induktiv gekoppelten<br />
Plasmareaktor (Ar2/H2, 13.65 MHz, 1000 W, 5 Pa) in die transparente<br />
Rückenhautkammer direkt auf den perfundierten Rückenhautmuskel<br />
platziert. Unbehandelte Proben dienten als Kontrolle. Die fluoreszenzmikroskopischen<br />
Analysen erfolgten an den Tagen 1, 5 und 10 nach<br />
Implantation in den Randbereichen von Implantat und umgebenden Gewebe.<br />
Im Anschluss wurden die mikrozirkulatiorischen Parameter functional<br />
vessel density (FVD), intervascular distance (IVD), microvessel<br />
diameter (D), micorvascular permeability (MVP), red blood cell velocity<br />
(VRBC) und leukocyte-endothelium interaction computergestützt ausgewertet.<br />
Ergebnisse: In beiden Gruppen konnte eine Zunahmen der Gefäßdichte<br />
in den Randbereichen von Implantat und umgebenden Geweben beobachtet<br />
werden. Dies zeigt sich auch in einer Zunahme der funktionellen<br />
Kapillardichter und der Gefäßdiameter von Tag 1 zu Tag <strong>10.</strong> Im Vergleich<br />
zur Kontrollgruppe ergaben sich in der Gasplasma-behandelten<br />
Gruppe signifikant höhere Werte für die funktionelle Kapillardichte an<br />
den Tagen 5 und <strong>10.</strong> In der Gasplasma-behandelten Gruppe erreichte die<br />
FVD 303,78±8 cm/cm² an Tag 5 und 335,48±12 an Tag 10, während<br />
in der unbehandelten Gruppe Werte von 275,21±5 cm/cm² an Tag 5<br />
und 293±10 cm/cm² erreicht wurden. Die Quantifizierung von MVP<br />
und VRBC reflektiert eine ungestörte Integrität und Perfusion der neugebildeten<br />
Gefäße sowohl in der Gasplasma-behandelten als auch in der<br />
Kontrollgruppe. Zudem konnte eine signifikante Abnahme von sticking<br />
leucocytes von Tag 1 zu Tag 10 in beiden Gruppen festgestellt und somit<br />
eine relevante inflammatorische Reaktion ausgeschlossen werde.<br />
Fazit: Als Reaktion auf den allogenen Knochenersatz kommt es zur<br />
Bildung eines neuen Gefäßnetzes mit stabiler Mikrozirkulation und<br />
ungestörten Integrität. Der Knochenersatz induziert keine relevante<br />
entzündliche Reaktion. Die Ergebnisse der intravitalmikroskopischen<br />
Studie zeigen, dass die Modifizierung der Materialoberfläche durch die<br />
Gasplasma-Behandlung die Vaskularisierung des Knochenersatzmaterials<br />
signifikant steigert und beschleunigt.<br />
P25 L Dermale Hautersatzmaterialien<br />
in der Plastischen Chirurgie<br />
Altmann S, Damert H-G<br />
Universitätsklinikum Magdeburg<br />
Schwere Verbrennungsnarben oder tiefreichende Verletzungen stellen<br />
häufig nicht nur ein funktionelles Problem dar, sie sind für die Patienten<br />
auch ästhetisch störend. Für die Narbenkorrektur oder Defektdeckung<br />
sind vielfältige Methoden beschrieben. Bei der Verwendung von Spalthaut-<br />
oder Vollhauttransplantaten kommt es jedoch häufig zu erneuten<br />
Kontrakturen beziehungsweise zu ästhetisch unbefriedigenden Ergebnissen.<br />
Durch den fehlenden Dermisanteil ist die Elastizität, die Reißfestigkeit<br />
und die gleichmäßige Textur der Haut vermindert.<br />
Methoden: Dermale Hautersatzmaterialien bestehen aus einer dreidimensionalen<br />
Matrix aus Kollagen und Elastin zum Aufbau einer sogenannten<br />
„Neodermis”. Wir berichten über unsere Erfahrungen mit der Verwendung<br />
von Integra bei der Korrektur von derben Narbenplatten durch<br />
Verbrennungen im Kindesalter. Weiterhin berichten wir über den Einsatz<br />
von Matriderm bei problematischen Defekten in der Handchirurgie.<br />
Ergebnisse: In allen Fällen konnte eine sichere Defektdeckung mit einer<br />
ansprechenden Ästhetik, einer hohen Reißfestigkeit und guten Elastizität<br />
der Haut erreicht werden.<br />
Fazit: Aufgrund der funktionellen und ästhetischen Probleme von Verbrennungsnarben<br />
ist man seit Jahren auf der Suche nach einem entsprechenden<br />
Hautersatz. Durch den Einsatz von dermalen Ersatzmaterialien<br />
werden viele dermale und epidermale Eigenschaften kopiert. Histologische<br />
Studien haben gezeigt, dass es zur Produktion einer Neodermis<br />
kommt. In unseren Fällen konnten sehr gute Ergebnisse in Bezug auf<br />
Elastizität der Haut, Narbenbildung und ästhetischem Ergebnis erzielt<br />
werden. Trotz der hohen Kosten kann mit dem gezielten Einsatz von<br />
Hautersatzstoffen das Repertoire in der Plastischen Chirurgie sinnvoll<br />
erweitert werden<br />
P26 L Verbrennung und COPD<br />
Ryu S-M, Pierson T, Menke H<br />
Klinikum Offenbach<br />
Poster | Donnerstag | 16.9.<strong>2010</strong><br />
Im Rahmen der ärztlich verordneten häuslichen Sauerstoffversorgung<br />
bei Patienten mit fortgeschrittenem COPD kann es bei leichtfertigem<br />
Umgang mit Feuer zu Verbrennungsunfällen kommen. Dabei wirkt der<br />
Sauerstoff in hoher Konzentration brandbeschleunigend und führt zu<br />
einer Verpuffungsreaktion, wenn es in Kontakt mit offenem Feuer oder<br />
Flamme als Zündquelle kommt.<br />
Hypothese: Die Problematik der Explosionsgefahr des Sauerstoffs bei Umgang<br />
mit Feuer scheint den Patienten mit häuslicher Sauerstofftherapie<br />
nicht in ausreichendem Maße bewusst zu sein.<br />
Methoden: In den letzten 12 Monaten wurden in unserem Verbrennungszentrum<br />
3 Patienten behandelt, die Verbrennungen in Verbindung mit<br />
einem mobilen Sauerstoffgerät erlitten. Hiervon werden zwei Fallbeispiele<br />
geschildert.<br />
Ergebnisse: Eine 70jährige Frau mit bekannter COPD wollte zu Hause<br />
eine Kerze ausblasen, wobei sie eine Sauerstoffmaske trug. Es kam zu<br />
einer Verpuffungsreaktion und die Patientin zog sich hierbei zweitgradige<br />
Verbrennungen im Gesichtsbereich von ca. 2 % der Körperoberfläche<br />
zu. Die Wunden wurden stationär mit Okklusionsverbänden versorgt,<br />
nach Demarkierung der Wunde wurde eine hochtourige Dermabrasio<br />
durchgeführt. Bei komplikationslosem Verlauf konnte die Patientin nach<br />
Hause entlassen werden. – Ein 78jähriger Mann mit bekannter COPD<br />
wollte trotz seines mobilen Sauerstoffgerätes eine Zigarette rauchen,<br />
wobei es zu einer Verpuffungsreaktion kam. Mit drittgradigen Verbren-<br />
82 Plastische Chirurgie 10 (Suppl. 1): 82 (<strong>2010</strong>)