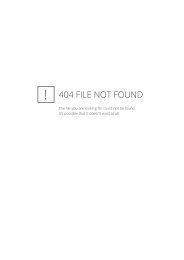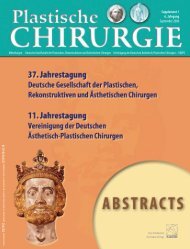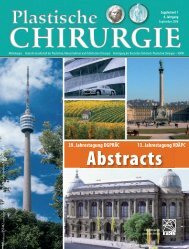Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Abstracts<br />
Wir haben an unserer Klinik Dermis der Patienten zur Bauchwandverstärkung<br />
genutzt und möchten unsere Resultate vorstellen.<br />
Methoden: Im Zeitraum von 3 Jahren wurden 10 Patienten mit einem autologen<br />
Dermisgraft zur Bauchwandverstärkung versorgt und in dieser<br />
Untersuchung eingeschlossen. In 9 Fällen wurde dieses Graft den nicht<br />
zur Rekonstruktion genutzten Zonen 3 und 4 entnommen (8 Patientinnen<br />
wurden mit DIEP versorgt, eine Patientin mit TRAM). In einem<br />
Fall wurde die Technik eingesetzt, nachdem mehrfache Versuche rezidivierende<br />
Bauchwandhernien bei Adipositas per magna mit Prolennetze<br />
zu versorgen, gescheitert waren. Hier wurde, nach massivem Gewichtsverlust<br />
das autodermale Transplantat von der resezierten Fettschürze<br />
gewonnen. Das Transplantat wurde bei den DIEP-Patienten und der<br />
Patientin mit rezidivierender Bauchwandhernierung in Onlay-Technik<br />
eingesetzt. Im Fall des muscle sparing TRAM wurde das Graft direkt in<br />
den Defekt eingebracht.<br />
Ergebnisse: Alle Patienten blieben postoperativ hernienfrei bei einem<br />
durchschnittlichen Follow-up von 10 Monaten. Eine Patientin entwickelte<br />
ein Serom, das operativ drainiert werden musste.<br />
Fazit: Überschüssige Haut ist fast immer zur Gewinnung eines autodermalen<br />
Transplantates verfügbar und erhöht weder Morbidität noch<br />
Länge der Operation. Es findet sich in der Regel genügend Gewebe, um<br />
sowohl Schwachstellen nach Lappenhebung zu verstärken als auch Faszienlücken<br />
einer chronischen Bauchwandhernierung zu überbrücken.<br />
Angesichts der potentiellen Serombildung ist es empfehlenswert, eine<br />
ausreichende postoperative Drainage zu gewährleisten. Die autodermale<br />
Transplantationstechnik führte in dieser kleinen Serie zu guten Resultaten<br />
ohne den Einsatz von prothetischem Material oder Allograft.<br />
P3 L Freie Musculus-latissimus-dorsi-Lappenplastik<br />
bei Kindern<br />
Namdar T, Stollwerck PL, Stang FH, Lange T, Mailänder P, Siemers F<br />
Universitätsklinikum Lübeck<br />
Nach freien M.-latissimus-dorsi-Lappenplastiken zur Rekonstruktion<br />
der unteren Extremität kann es zu einem vollständigen Verlust der freien<br />
Lappenplastik kommen.<br />
Hypothese: Bei Kindern besteht ein relevantes Risiko für einen kompletten<br />
Verlust der freien M. latissimus dorsi Lappenplastiken.<br />
Methoden: Retrospektive Studie. Bei 11 Kindern wurden posttraumatisch<br />
freie M. latissimus dorsi Lappenplastiken an der unteren Extremität<br />
durchgeführt. Die operativen Revisionen, die stationären Liegezeiten<br />
und die Lappenverlusterate wurden analysiert.<br />
Ergebnisse: Das Alter betrug 13±4 Jahre (Mittelwert±Standardabwei<br />
chung). Die Krankenhausverweildauer betrug 46±18 Tage. Im Mittel<br />
waren pro Fall 1,4±0,8 Revisionen aufgrund von lokalen Wundheilungsstörungen<br />
notwendig. 14 freie M.-latissimus-dorsi-Lappenplastiken<br />
wurden bei 11 Kindern durchgeführt. 10 freie M.-latissimus-dorsi-<br />
Lappenplastiken heilten vollständig ein. In einem Fall kam es zu einem<br />
partiellen und in 3 Fällen zu einem kompletten Lappenverlust.<br />
Fazit: Freie M.-latissimus-dorsi-Lappenplastiken bei Kindern stellen eine<br />
hilfreich Therapieoption zur Defektdeckung an der unteren Extremität<br />
dar. Es besteht ein relevantes Lappenverlustrisiko.<br />
P4 L Planung des Resektionsgewichtes<br />
bei Mammareduktionen<br />
Tabar TS, Allert S<br />
Kreiskrankenhaus Hameln<br />
Poster | Donnerstag | 16.9.<strong>2010</strong><br />
Mammareduktionen gehören zu den häufigsten Eingriffen an den<br />
Brüsten und stellen einen wesentlichen Anteil plastisch chirurgischer<br />
Operationen dar. Thema unterschiedlicher Veröffentlichungen ist das<br />
zu erwartende Resektionsgewicht. Im Februar 2008 erschien die Veröffentlichung<br />
einer südafrikanischen Arbeitsgruppe mit einer Formel<br />
(=(35,4×Jugulum-Mamillen-Abstand+60,66×Steg-Länge)–1239,64)<br />
zur Abschätzung des Reduktionsgewichtes für Brustverkleinerungen<br />
[Descamps MJ, et al (2008) A formula determining resection weights for<br />
reduction mammaplasty. Plast Reconstr Surg 121: 397-400].<br />
Hypothese: Auf Grund häufiger und starker Unterschiede zwischen dem<br />
zu erwartenden und dem tatsächlichen Resektionsgewicht erfolgte die<br />
Überprüfung der veröffentlichten Formel.<br />
Patienten und Methoden: In unserer Studie wurden 144 Mammareduktionen<br />
bei 77 Patientinnen im Zeitraum von 2006 bis 2009 retrospektiv<br />
ausgewertet. Sowohl die prä- und postoperativ ermittelten klinischen<br />
Werte, die oben genannte Formel, der OP-Befund, das chirurgische Resektionsgewicht<br />
wie auch die standardisierten Fotodokumentationen<br />
dienten der Befunderhebung und -auswertung. Es erfolgten ausschließlich<br />
Mammareduktionen mit inferiorer Stielung nach der Operationsmethode<br />
nach Robbins. Nicht einbezogen wurden reine Straffungsoperationen<br />
oder Reduktionen nach Lejour. Die Operationen wurden durch<br />
zweier Teams aus 4 konstanten Operateuren durchgeführt.<br />
Ergebnisse: In der südafrikanischen Veröffentlichung wurde die Resektionsgewichtsbreite<br />
von 600 bis 1600 g als besonders präzise abschätzbares<br />
Reduktionsvolumen anhand der Formel eingegrenzt. Daher erfolgte<br />
in unserer Studie eine Einteilung in 3 Resektionsgruppen (1600 g). Das jeweilige errechnete Resektionsgewicht wurde<br />
mit dem endgültigen chirurgischen Resektionsgewicht verglichen und<br />
in Relation gesetzt. Es zeigte sich jedoch in allen 3 Resektionsgruppen<br />
keine signifikante und verifizierbare Korrelation. Bei den Resektionsgewichten<br />
1600 g waren<br />
Resektionsunterschiede von mindestens 670 g bis zu 1040 g zu verzeichnen,<br />
ein gemittelter prozentualer Fehler von 55,19 und eine Standardabweichung<br />
von 11,28 sind die Folge.<br />
Fazit: Die veröffentlichte Formel sollte als Anhalt für operative Planungen<br />
dienen. Die Anwendung der Formel ist bei unseren Resektionsgewichten<br />
jedoch nicht signifikant nachvollziehbar. Wir befinden uns<br />
derzeit in einer prospektiven Überprüfungsphase einer retrospektiv ermittelten<br />
Formel für Mammareduktionen.<br />
74 Plastische Chirurgie 10 (Suppl. 1): 74 (<strong>2010</strong>)