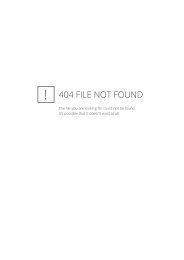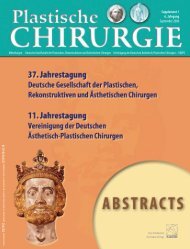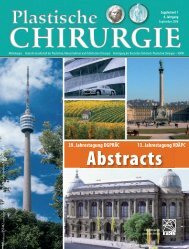Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Poster | Donnerstag | 16.9.<strong>2010</strong><br />
lebensdauer von Wochen bis wenigen Monaten nach Auftreten der Melanosis.<br />
Uneinigkeit herrscht über den Pathogenese der Hautverfärbung,<br />
deren Mechanismus noch diskutiert wird.<br />
Methoden: Dargestellt wird der Krankheitsverlauf einer 45jährigen Patientin<br />
mit disseminierter Multiorganmetastasierung bei exophytisch,<br />
exulceriertem malignen Melanom am Schulterblatt. Bereits bei Erstdiagnose<br />
im Dezember 2009 fand sich eine gesichts- und stammbetonte<br />
Melanosis cutis und Melanurie. Die Patientin befand sich in einem sehr<br />
geschwächten Allgemeinzustand mit Anämie und Lebersynthesestörung.<br />
Nach ausreichender Stabilisierung und Substitution konnte ein<br />
chirurgisches Tumordebulking vorgenommen und ein zentralvenöser<br />
Port angelegt werden. Im Anschluss erhielt die Patientin den 1. Zyklus<br />
einer palliativen Polychemotherapie nach dem BHD-Protokoll. Anhand<br />
von Fotos wird der eindrucksvolle Verlauf der Hautverfärbung laborchemischen<br />
und histopathologischen Parametern gegenüber gestellt.<br />
Ergebnisse: Die Melanosis cutis hat unter der Chemotherapie deutlich an<br />
Intensität zugenommen, wobei es laborchemisch und klinisch zu einer<br />
Stabilisierung und Erholung der Patientin gekommen ist. Der anfänglich<br />
rasch exophytisch wachsende Tumor ist nach chirurgischem Debulking<br />
in partieller Remission. Die Tumormarker sind gesunken. Histopathologisch<br />
sind in der verfärbten Haut keine malignen Melanomzellen sondern<br />
lediglich pigmentierte Makrophagen erkennbar. Weitere Chemotherapiezyklen<br />
sind geplant.<br />
Fazit: Trotz zahlreicher Aufklärungsprogramme und kostenlosen Früherkennungsuntersuchungen<br />
für das maligne Melanom führen mitunter<br />
erst sichtbare Stigmatisierungen betroffene Patienten zum Arzt. Sehr<br />
selten ist dabei eine Melanosis cutis, die wie in unserem Fall äußerst<br />
eindrucksvoll das gesamte Integument der Patientin nahezu negroid<br />
verfärbt hat. Trotz sehr schlechter Lebenserwartung ist eine supportive,<br />
palliative chirurgische und chemotherapeutische Behandlung indiziert.<br />
P38 L Intravaskuläre Leiomyosarkome – eine seltene<br />
tumorentität. Klinisch-pathologische studie von 12 Fällen<br />
Tilkorn D-J, Hauser J, Ring A, Stricker I, Steinau H-U, Kuhnen C<br />
BG-Universitätsklinikum Bergmannsheil Bochum<br />
Leiomyosarkome mit intravaskulären Ursprung stellen eine sehr seltene<br />
Untegruppe maligner Weichgewebstumore dar. Während die überwiegende<br />
Anzahl das Retroperitoneum und hier vor allem die V. cava inferior<br />
betreffen, werden sie nur selten in den Gefäßen der Extremitäten<br />
angetroffen. Nach einer bioptisch gesichterten Diagnose eines Leiomyosarkoms<br />
muss jedoch der seltene Fall eines intravaskulären Tumorurspungs<br />
berücksichtigt werden, da sich hieraus entscheidende Veränderungen<br />
in der chirurgischen Strategie ergeben können.<br />
Methode: Im Zeitraum von 2000 bis 2009 wurden zwölf Patienten mit<br />
einem intravaskulären Leiomyosarkoms im Universitätsklinikum<br />
Bergmannsheil in Bochum behandelt. Daten bezüglich des klinischen<br />
Verlaufs, Nachsorge und Outcomes wurden retrospektiv erhoben. Ein<br />
besonderer Augenmerk wurde auf das Überleben, das Auftreten von Rezidiven<br />
und Metastasen gerichtet.<br />
Ergebnisse: Intravaskluäre Leiomyosarkome machten 0,7 % aller malignen<br />
Weichgewebstumoren aus. Das Nachuntersuchungsintervall betrug<br />
im Mittel 38 Monate. Sechs Patienten erlitten ein Tumorrezidiv.<br />
Metastasen wurden ebenfalls in sechs Patienten beobachtet. Mit einer<br />
5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit von 57 Prozent war die Prognose<br />
dieser Patienten sehr erst.<br />
Fazit: Leiomyosarkome mit einem intravskulären Ursprung stellen eine<br />
seltene jedoch aggressive Tumorentität mit einer hohen Rezidiv- und<br />
Metastasierungsrate dar. Der besondere Ursprung der Malignome beeinflusst<br />
die chirurgische Strategie und erfordert eine sorgfälltige präoperative<br />
Diagnostik.<br />
Plastische Chirurgie 10 (Suppl. 1): 87 (<strong>2010</strong>)<br />
P39 L Lebensrettende Plastische Chirurgie<br />
bei Kindbettfieber<br />
Giesler T<br />
Klinikum Kassel<br />
Abstracts<br />
Dargestellt wird ein Krankheitsverlauf bei Kindbettfieber. Nach ambulanter<br />
Entbindung wurde die Patientin zunächst nach Hause entlassen.<br />
Am 3. Tag erfolgte eine fulminante Verschlechterung des Allgemeinzustandes<br />
mit Einweisung in ein peripheres Krankenhaus. Hier kam es<br />
innerhalb weniger Stunden zum Kreislaufzusammenbruch mit respiratorischem<br />
Versagen. Im septischen Schock wurde die Patientin in ein<br />
größeres Krankenhaus verlegt und es erfolgte die Not-Hysterektomie,<br />
die auch keine Besserung des Zustandes ergab. Diagnose: Toxic Schock<br />
Syndrom mit Multiorganversagen bei Puerperal-Sepsis. Es vielen Hautnekrosen<br />
an beiden Unterschenkeln auf und die Patientin wurde den<br />
Plastischen Chirurgen vorgestellt. Die operative Revision zeigte Rhabdomyolysen<br />
nahezu der gesamten Unterschenkelmuskulatur. Nach<br />
radikalem Debridement und VAC-Therapie besserte sich der Zustand<br />
allmählich und es konnten letztlich mit einer einfachen Hauttransplantation<br />
die Wunden zur Abheilung gebracht werden. Durch die optimale<br />
Intensivtherapie und die plastisch-chirurgische Therapie hat die Patientin<br />
überlebt und kann trotz Fehlen von M. gastrocnemius und soleus<br />
ohne Hilfsmittel gehen.<br />
P40 L Die sensible Adominoplastik<br />
Becker F, Lindlar I, Kuipers T, Schoeller T<br />
Marienhospital Stuttgart<br />
Die Abdominoplastik ist eine Operation, die im Rahmen der bariatrischen<br />
Therapie sowie als ästhetischer Eingriff mit stetig steigender<br />
Frequenz durchgeführt wird. Um den gesteigerten Ansprüchen gerecht<br />
zur werden, ist es notwendig, die operativen Techniken weiter zu verfeinern.<br />
Bei der konventionellen Methode ist postoperativ das Areal zwischen<br />
Nabel und Narbe oft hypo-, wenn nicht asensibel. Hier gilt es, die<br />
Operationsmethode zu verbessern, um den Comfort für die Patienten<br />
zu steigern.<br />
Hypothese: Eine Besserung der Sensibilität der Araele kranial der Narbe<br />
der Abdominoplastik, insbesondere unterhalb des Nabels kann durch<br />
eine sensible Augmentation erreicht werden.<br />
Methode: Es wurde eine prospektiven Einzelfalluntersuchung durchgeführt.<br />
Hierzu wurde bei einer Patientin ein sensibler Nerv der Bauchwand<br />
am kaudalen Wundrand präpariert. Bei der epifaszialen Mobilisation<br />
wurde oberhalb des Nabels ebenfalls ein sensibler Hautnerv zur<br />
Bauchwand geschont und freipräpariert. Dieser Nervenast wurde vor<br />
dem Wundverschluss spannungsfrei mit dem kaudalen, sensiblen Nerven<br />
der Bauchwand koaptiert.<br />
Ergebnisse: Nach Abwarten der Regeneration bestand auf der sensibel<br />
augmentierten Seite eine bessere Sensibilität als auf der konventionell<br />
operierten Seite.<br />
Fazit: Die Einschränkung der Sensibilität des Areales kranial der Narbe<br />
nach Abdominoplastik kann durch eine sensible Augmentation reduziert<br />
werden. Sollte sich die Hypothese in weiteren Fällen verfestigen,<br />
ist eine einfach blinde, randomisierte Studie mit einer beidseitig sensibel<br />
augmentierten Abdominoplastik vs. konventioneller Abdominoplastik<br />
geplant.<br />
87