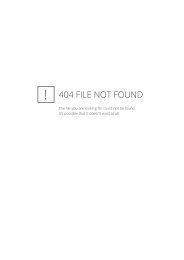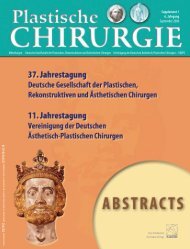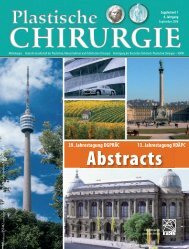Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Abstracts<br />
um ca. 15 % im ischämisch geschädigten Lappenareal in den behandelten<br />
Tieren gegenüber den Kontrolltieren festgestellt. Das hier skizzierte<br />
Verfahren der „Therapeutischen Angiogeneseinduktion“ stellt eine Art<br />
der Präkonditionierung im später ischämisch gefährdeten Gewebe dar.<br />
P19 L Nitinol-Netze und Fettstammzellen –<br />
ein Hybridimplantat<br />
Strauß S, Dudziak S, Barcikowski S, Herzog D, Reimers K, Vogt PM<br />
Medizinische Hochschule Hannover<br />
Aufgrund ihrer mechanischen Eigenschaften stellt die Legierung Nitinol<br />
(NiTi) eine interessante Option als Osteoimplantat dar. Jedoch ergeben<br />
sich auch hier die Nachteile eines jeden metallischen Vollimplantats wie<br />
schlechte Integration und daraus resultierende Implantat-Lockerung<br />
und Entzündungsreaktionen. Die Lösung der Problematik könnte ein<br />
netzartiges Implantat sein, welches vor Implantation mit patienteneigenen<br />
Fettstammzellen (ASC) besiedelt wurde. ASCs können unter gegebenen<br />
Bedingungen osteogen differenzieren und so die Neubildung von<br />
Knochen an der Defektstelle unterstützen. Die Netzstruktur bietet die<br />
Möglichkeit zur Vaskularisation und damit eine optimale Versorgung des<br />
neuentstehenden Gewebes.<br />
Hypothese: Eine Kombination aus netzartig strukturiertem NiTi und Fettstammzellen<br />
bietet optimale Eigenschaften zur Besiedlung mit ASC und<br />
deren osteogener Differenzierung um in Zukunft anstelle von metallischen<br />
Vollimplantaten zur Osteoimplantation bei Defekten verwendet<br />
zu werden.<br />
Material und Methoden: NiTi-Netze mit unterschiedlicher Stegbreite und<br />
Mesh-Dichte werden mittels selektivem Lasersintern generiert und mit<br />
ASC besiedelt. Die ASC wurden zuvor aus humanem Fettgewebe isoliert<br />
und bis zu vier Mal passagiert. Die Kultivierung erfolgt 24 h bis 48 h für<br />
Kurzzeitanalysen und bis zu 6 Wochen für die osteogene Differenzierung.<br />
Die osteogene Differenzierung wird chemisch über das Medium<br />
induziert. Das Zellverhalten auf den Trägern wird mittels Rasterelektronenmikroskopie,<br />
Histologie und Immunfluoreszenz untersucht.<br />
Ergebnisse: Rasterelektronen- bzw. Lichtmikroskopie zeigen normales<br />
Zellverhalten bzw. -aussehen. Kontrollen auf Titan-Trägern zeigen ein<br />
vergleichbares Bild (nicht abgebildet) Im Verlauf der osteogenen Differenzierung<br />
bilden die ASC eine dicke Extrazellularmatrix (ECM) aus,<br />
auch dies lässt sich auf den Kontrollen beobachten. Chemisch induziert<br />
differenzieren ASC auf NiTi-Netzen osteogen. Es lassen sich für die<br />
osteogene Differenzierung charakteristischen Faktoren wie z.B. BMP-<br />
6 nachweisen. Auch in der calciumspezifischen Alizarin red Färbung<br />
konnte die gewünschte Mineralisation der ECM nachgewiesen werden.<br />
Fazit: ASC adhärieren, proliferieren und differenzieren osteogen auf Ni-<br />
Ti-Trägern mit Netzstruktur. Zur Implantation sind 24–48 h besiedelte<br />
Träger am besten geeignet, da in dieser Phase nur die Netzstege von<br />
Zellen umhüllt sind. Bei längerer Kultivierung überwuchern die Zellen<br />
das Netz komplett und bilden eine dicke ECM. Dies könnte die Vaskularisation<br />
erschweren. Das allergene Potential von NiTi-Implantaten wird<br />
derzeit kontrovers diskutiert und soll auch im Rahmen dieser Arbeit in<br />
Zukunft Beachtung finden. Darüber hinaus ist die Erprobung des netzartigen<br />
Hybridimplantats im Tiermodell geplant, um die Integration und<br />
Vaskularisation weitergehend zu analysieren.<br />
P20 L sensibilisierung resistenter tumoren für<br />
klassische therapien durch Herunterregulierung<br />
apoptosehemmender Gene<br />
Bucan V, Reimers K, Lazaridis A, Vogt PM<br />
Medizinische Hochschule Hannover<br />
Poster | Donnerstag | 16.9.<strong>2010</strong><br />
Die Proteinkinase Akt/PKB (Proteinkinase B) nimmt in ihrer aktivierten<br />
Form als Bestandteil des durch Stimulation zahlreicher Wachstumsfaktorrezeptoren<br />
stimulierten PI3K/Akt-Signaltransduktionsweges eine<br />
zentrale Rolle als antiapoptotischer Signalvermittler ein. In Tumoren ist<br />
der PI3K/Akt-Weg häufig dereguliert und eine aberrante Aktivierung<br />
von Akt resultiert in einem in der Regel fortgeschrittenen und aggressiven<br />
Phänotyp sowie Resistenz gegenüber zytotoxischer Behandlung und<br />
Neoangiogenese.<br />
Hypothese: Das bislang wenig charakterisierte antiapoptotische membranassoziierte<br />
Protein Lifeguard (LFG) ist an der Aufrechterhaltung von<br />
Konditionen beteiligt, die die Apoptoseinduktion entscheidend vermindern.<br />
In eigenen Vorarbeiten konnten wir die Regulation der LFG-Expression<br />
durch den LEF-1/Akt-Signalweg nachweisen. Es sollte nun die<br />
Hypothese überprüft werden, dass durch Herunterregulation von LFG<br />
die Sensitivität gegenüber Perifosine, das mit der Akt-Aktivierung assoziiert<br />
ist, gesteigert wird.<br />
Methoden: In den Versuchen wurden in tumorigenen Kulturen E1/E3<br />
deletierte adenovirale Serotyp-5-Vektoren eingesetzt. Die erfolgreiche<br />
LFG-Gensuppression durch die RNAi-Ansätze wurde mittels RT-PCR<br />
analysiert. In den Versuchsreihen wurden MCF-7-Mammakarzinomkulturen<br />
und SW872 Sarkomkulturen mit steigenden Perifosinekonzentrationen<br />
von 2–20 µM über einen Zeitraum von 2 bis 48 Stunden behandelt.<br />
Es folgten Bestimmungen der Zellvitalität mittels Apoptoseassay in<br />
allen Versuchsreihen.<br />
Ergebnisse: 48 Stunden nach der Zugabe von LFG-RNAi-Ansätzen zeigte<br />
sich eine deutliche Gensuppression in MCF-7- und SW872-Zelllinien.<br />
Die LFG-Expression betrug zu dem Zeitpunkt nur noch 18 % in Vergleich<br />
zu Kontrollen. Zusätzliche Behandlung der Zellen Perifosine hatte<br />
steigende Apoptoseraten in beiden Zelllinien zur Folge verglichen mit<br />
der Kontrollreihen. Dabei zeigte sich eine deutliche Dosis und Zeit-abhängige<br />
Korrelation.<br />
Fazit: Die Ergebnisse geben Aufschluss über die Apoptosesensibilisierung<br />
unter der Geninaktivierung von LFG bei verschiedenen Karzinom-Zelltypen<br />
und sollen in Zukunft auf weitere resistente Tumoren im Hinblick<br />
auf klinisch zugelassene Chemotherapeutika ausgeweitet werden.<br />
P21 L Glands as a potential source of tissue resident<br />
endothelial progenitor cells<br />
Zhang Z, Hopfner U, Danner S, Kremer M, Kruse C, Machens H-G, Egana JT<br />
Klinikum rechts der Isar der TU München<br />
Several studies have shown the existence of circulating and bone marrow<br />
derived endothelial progenitor cells (EPCs). These cells are responsible<br />
of adult vasculogenesis and play an important role in wound healing and<br />
tissue regeneration. Although it is clear that EPC reside in bone marrow,<br />
new evidences support the idea of alternative EPCs niches. Here we<br />
show evidence in vitro and in vivo of the possible role of exocrine glands<br />
as a new source of EPC.<br />
Methods: Gland stem cells were isolated from pancreas and salivary<br />
glands from a Tie2-LacZ genetically modified mouse. Then, cells were<br />
cultivated in endothelial differentiation medium. Afterwards, endothelial<br />
features were analyzed in vitro and in vivo.<br />
80 Plastische Chirurgie 10 (Suppl. 1): 80 (<strong>2010</strong>)