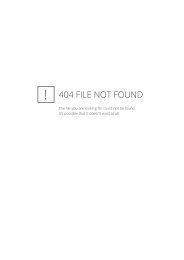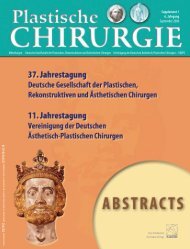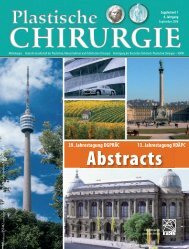Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Vorträge | Donnerstag | 16.9.<strong>2010</strong><br />
Vorträge<br />
Hand 1<br />
Donnerstag, 9:00–10:00 Uhr, Großer Saal<br />
V1 L Frakturen des Karpus – Analysealgorithmus für die<br />
strukturierte beurteilung konventioneller Röntgenbilder<br />
Spanholtz TA, Phan TQV, Perbix W, Spilker G<br />
Klinikum Köln-Merheim, Universität Witten/Herdecke<br />
Als Primärbildgebung bei Traumata oder chronischen Schmerzen der<br />
Handwurzel gilt die konventionelle Röntgenuntersuchung. Die Beurteilung<br />
dieser Röntgenbilder stellt den beurteilenden Assistenzarzt<br />
vor große Herausforderungen. Immer wieder werden direkt sichtbare<br />
Verletzungszeichen bzw. deren indirekt sichtbaren Folgen übersehen<br />
oder falsch eingeschätzt. Es existiert gegenwärtig kein vereinheitlichtes,<br />
strukturiertes Vorgehen zur Erstbeurteilung konventioneller Röntgenaufnahmen<br />
des Karpus. Ziel ist die Präsentation der häufigsten Knochen-<br />
und Bandverletzungen und die Zusammenfassung sicherer radiologischen<br />
Zeichen.<br />
Hypothese: Wir präsentieren einen Algorithmus zur strukturierten Beurteilung<br />
häufiger Karpusverletzungen.<br />
Methodik: Wir analysierten 100 zufällig ausgewählte Röntgenbilder aus<br />
unserer handchirurgischen Sprechstunde und glichen die beschriebenen<br />
Diagnosen mit den tatsächlich sichtbaren Verletzungen ab. Aus<br />
den Erkenntnissen dieser internen Untersuchung und aus den häufig<br />
übersehenen Verletzungen entwickelten wir einen Vorschlag für einen<br />
strukturierten Analysealgorithmus für die Primärneurteilung karpaler<br />
Röntgenbilder durch handchirurgische Assistenzärzte.<br />
Ergebnis: Voraussetzung für die Beurteilung ist ein korrekt ausgerichtetes<br />
seitliches und ein dorsopalmares Bild. Die strukturierte Beurteilung des<br />
Bildes beginnt im dorsopalmaren Bild im distalen Radioulnargelenk und<br />
findet dann schrittweise vom radioscaphoidalen Gelenk ausgehend im<br />
Uhrzeigersinn statt. Hierbei ist primär auf Frakturen und Gefügestörungen,<br />
sowie Arthrosezeichen zu achten. Im seitlichen Bild werden das<br />
Lunatum und das Capitatum identifiziert und die wichtigsten Winkel<br />
bestimmt, sowie die karpale Höhe gemessen. Die Anwendung dieses<br />
Strukturierten Vorgehens wurde in der handchirurgischen Sprechstunde<br />
angewendet und führte zu einer zuverlässigen Steigerung der Beurteilungsqualität<br />
der Röntgenbilder.<br />
Fazit: Die korrekte Beurteilung karpaler Verletzungen setzt einen strukturierten<br />
Analysealgorithmus der Röntgenbilder voraus. Dieser ermöglicht<br />
auch Anfängern eine vollständige und fehlerarme Bewertung vorliegender<br />
Verletzungen. Der vorgestellte Algorithmus soll als Vorschlag<br />
verstanden werden und muss einer stetigen Weiterentwicklung unterliegen,<br />
um auch Röntgenzeichen zu erkennen, die auf komplexere ?versteckte?<br />
Verletzungen hinweisen.<br />
V2 L Fgf-9 wird für die Knochenregeneration benötigt<br />
Behr B, Leucht P, Longaker MT, Quarto N<br />
BG-Unfallklinik Ludwigshafen<br />
Im Rahmen der Frakturheilung ist eine komplexe Interaktion von Cytokinen<br />
notwendig, die eine effiziente Regeneration zu ermöglicht. Fibroblast<br />
Growth Factors (Fgfs) -2, -9, und -18 gelten als bedeutsam für die<br />
skeletale Entwicklung, jedoch wurde ihre Rolle in der Knochenregeneration<br />
bisher nicht hinreichend untersucht.<br />
Hypothese: Fgf-9 hat Einfluss auf die Knochenregeneration.<br />
Plastische Chirurgie 10 (Suppl. 1): 5 (<strong>2010</strong>)<br />
Abstracts<br />
Methoden: Tibiale Knochendefekte von 1mm Durchmesser wurden unikortikal<br />
in Fgf-9+/- und Wildtyp Mäusen erzeugt. Diese wurden an den<br />
Tagen 3, 5 und 7, welche die Frakturstadien Inflammation/Angiogenese,<br />
Kallusbildung und Remodelling repräsentieren, histologisch untersucht.<br />
Die Genexpression von osteogenen und angiogenen Faktoren wurde auf<br />
mRNA-Ebene untersucht und mit immunhistochemischen Untersuchungen<br />
ergänzt. Darüber hinaus wurde die Neovaskularisierung der<br />
Frakturzone in Fgf-9+/- und Wildtyp Mäusen mit µCT-Angiographien<br />
untersucht. Zur Kompensation der Knochenregeneration wurde FGF-9<br />
in Knochendefekten von Fgf-9+/-Mäusen appliziert.<br />
Ergebnisse: Histomorphometrische Studien zeigten, dass die Haploinsuffizienz<br />
von Fgf-9 die Knochenregeneration erheblich beeinträchtigte.<br />
Immunhistochemie und RT-PCR Analysen ließen reduzierte Expressionsniveaus<br />
der proliferativen und osteogenen Faktoren PCNA, Runx2,<br />
Osteocalcin, in Fgf-9+/-Defekten erkennen. Interessanterweise zeigte<br />
sich außerdem in VEGFA/PECAM-1-Färbungen und Genexpressionsanalysen<br />
eine erhebliche Beeinträchtigung der Angiogenese an Tag 3<br />
in Fgf-9+/- Defekten. µCT-Angiographien stellten eine erhebliche Beeinträchtigung<br />
der Neovaskularisierung in Fgf-9+/- – im Vergleich zu<br />
Wildtyp Mäusen dar. Die Behandlung von Fgf-9+/- Defekten mit FGF-<br />
9 Protein förderte die Angiogenese und erhöhte die Heilungskapazität<br />
in Fgf-9+/- Mäusen. Interessanterweise konnten andere proosteogene<br />
Faktoren (Fgf-2, Fgf-18 und Bmp-2), welche weiterhin in Fgf-9+/-Defekten<br />
nachgewiesen werden konnten, die Haploinsuffizienz von Fgf-9<br />
im Rahmen der Knochenregeneration nicht kompensieren.<br />
Fazit: Zusammenfassend weisen unsere Daten auf eine einzigartige endogene<br />
Rolle von Fgf-9 in der Knochenregeneration hin, unter anderem<br />
durch die Initialisierung der Angiogenese durch Vegfa. Darüber hinaus<br />
unterstützt diese Studie einen zuvor beschriebenen entwicklungsbiologischen<br />
Phenotyp in der Extremität und propagiert somit das Konzept,<br />
dass adulte Knochenheilungsprozesse die embryonale skeletale Entwicklung<br />
rekapitulieren.<br />
V3 L Klinische und radiologische retrospektive studie<br />
zur Untersuchung der Ätiopathogenese und der therapieergebnisse<br />
der Lunatumnekrose<br />
Stahl S, Merz M, Pfau M, Schaller H-E<br />
BG-Unfallklinik Tübingen<br />
Die Vielfalt veröffentlichter operativer Verfahren zur Behandlung der<br />
Mondbeinnekrose suggeriert, dass ein gezieltes Eingreifen in den Krankheitsprozess<br />
bislang noch nicht gelungen ist. Eine Studie wurde durchgeführt<br />
zur Untersuchung des Behandlungsergebnisses bei Mondbeinnekrose.<br />
Hypothese: Die Kienböck’sche Erkrankung wird durch Durchblutungsstörungen<br />
und/oder einer Ulnaminusvarianz hervorgerufen und kann<br />
daher durch Revaskularisierung mittels eines gefäßgestielten Radiusspan<br />
und/oder einer Radiusverkürzungsosteotomie zum Stillstand gebracht<br />
werden.<br />
Methoden: Zwischen 2000 und 2009 wurden 43 Patienten mit einer<br />
Mondbeinnekrose behandelt, davon 2 konservativ. 38 Patienten konnten<br />
mit einer durchschnittlichen Nachuntersuchungszeit von 4,3 Jahre<br />
(Minimum 6,9 Monate, Maximum 9,7 Jahre) postoperativ untersucht<br />
werden. 5 Patienten waren nicht erreichbar bzw. einer Nachuntersuchung<br />
gegenüber nicht aufgeschlossen. Abhängig von der Stadieneinteilung<br />
und der klinischen Symptomatik kamen verschiedene Operationstechniken,<br />
teils auch mehrere Operationstechniken während eines<br />
Eingriffes in Betracht. Die präoperative Diagnostik stützte sich stets auf<br />
eine eingehende klinische Untersuchung, eine konventionelle Röntgen-<br />
Untersuchung beider Handgelenke in 2 Ebenen sowie einer MRT-Un-<br />
5