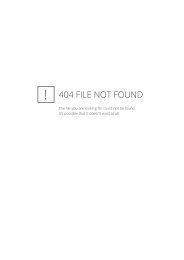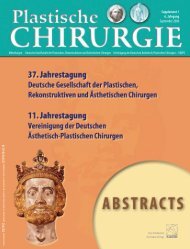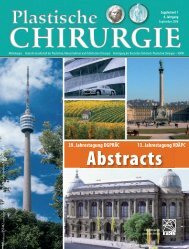Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Vorträge | Samstag | 18.9.<strong>2010</strong><br />
erster Schritt hin zu Sanktionierungsbestrebungen interpretiert werden.<br />
Die notwendige Folge ist, dass vor medizinisch nicht indizierten ästhetischen<br />
Eingriffen auf die geänderten Regelungen, insbesondere auf die<br />
möglichen drohenden finanziellen Auswirkungen bei Komplikationen<br />
hingewiesen werden muss. Die Notwendigkeit einer Folgekostenversicherung<br />
ist in Abhängigkeit der Leistung und entstehenden Kosten in<br />
Erwägung zu ziehen.<br />
V144 L Die Prozesskostenrechnung als ein Mittel zur<br />
Positionierung der Kernkompetenzen der Plastischen<br />
Chirurgie<br />
Altintas AA, Hierner R<br />
Universitätsklinikum Essen<br />
Die Plastische Chirurgie ist durch stetige Entwicklung neuer Verfahren<br />
interdisziplinär tätig. Doch nicht selten wird das operative know-how<br />
durch andere Fachbereiche verkannt. Überschneidungen zu anderen<br />
Fachrichtungen könnten sich unter anderem durch Effizienz und Ökonomie<br />
abgrenzen lassen. Durch das vorgegebene DRG System ist die Erlösseite<br />
zumeist gedeckelt. Zur ökonomischen Optimierung bleibt somit<br />
die Kostenseite. Ziel dieser Arbeit ist es, die Möglichkeiten der Prozesskostenrechnung<br />
(PKR) als ein Mittel zur Positionierung der Kernkompetenzen<br />
der Plastischen Chirurgie gegenüber anderen Fachrichtungen<br />
aufzuzeigen. Es werden Grundlagen und Tipps zur Umsetzung der PKR<br />
dargestellt und auf die zu erwartenden Schwierigkeiten hingewiesen.<br />
Material und Methode: Die PKR bietet im Rahmen der Prozessanalyse eine<br />
Methode zur effektiven Kostenanalyse. Speziell sollte sich der Fokus an<br />
die Teilprozesse richten, die häufig auftreten oder hohe Kosten verursachen.<br />
Dabei müssen die „Cost Driver“, die für die Kostenentwicklung<br />
der Prozesse entscheidend sind identifiziert und analysiert werden. Der<br />
größte Aufwand besteht dabei in der Informationsverarbeitung und Kostenzuordnungen.<br />
Ergebnisse: Bei der Einführung der PKR kann durch eine frühe Abstimmung<br />
mit dem nach §137 SGB V für die Kliniken verpflichtenden Qualitäts<br />
Management (QM), die Akzeptanz gesteigert und der Aufwand<br />
reduziert werden. Insgesamt ist zu beachten, dass die Nutzung der QM<br />
zwar von Vorteil ist, jedoch ihre Priorität in einer vollständigen Ablaufübersicht<br />
besteht. Die PKR dagegen zielt auf die von Kostentreibern beeinflussten<br />
Teilprozesse ab.<br />
Fazit: Um Kernkompetenzen der Plastischen Chirurgie gegenüber anderen<br />
Fachrichtungen klarer zu positionieren kann die PKR im Gegensatz<br />
zu den traditionellen Kostenrechnungen, wichtige Argumente bieten.<br />
Zukünftig könnte die PKR auch aufgrund seiner Vollkostendarstellung<br />
eine notwendige Grundlage für die INek Kalkulation und somit neben<br />
der Kostenoptimierung auch eine Erlössteigerung im Fallpauschalsystem<br />
darstellen; der Erfolg hängt dabei stark von der konkreten Umsetzung ab.<br />
V145 L Der schichtübergreifende Weichteildefekt –<br />
Ein stiefkind des DRG-systems<br />
Hellmich S, Czermak C, Lehnhardt M, Megerle K<br />
BG-Unfallklinik Ludwigshafen<br />
Die Behandlung des schichtübergreifenden Weichteildefektes ist eine<br />
Hauptdomäne der plastischen Chirurgie. Die Ätiologie der Defekte ist<br />
ganz unterschiedlich. Sie können posttraumatisch, postoperativ, infektiös<br />
oder beispielsweise durch Druck entstehen. Gemeinsam ist ihnen<br />
jedoch, dass für die erfolgreiche Therapie ein Verfahren der Rekonstruktiven<br />
Leiter der Plastischen Chirurgie Anwendung findet. Für die Wahl<br />
der richtigen Hauptdiagnose steht eine Fülle von ICD-Nummern zur<br />
Plastische Chirurgie 10 (Suppl. 1): 57 (<strong>2010</strong>)<br />
Abstracts<br />
Verfügung – allerdings beschreibt keine von ihnen unmissverständlich<br />
einen schichtübergreifenden Weichteildefekt. Immer dann, wenn keine<br />
eindeutige Hauptdiagnose zur Auswahl steht, ist eine Konfrontation mit<br />
dem Medizinischen Dienst der Krankenkasse (MDK) vorprogrammiert.<br />
Dieser wird durch die Erlöse/Kosten, die hinter den jeweiligen Hauptdiagnosen<br />
und den daraus generierten DRG stehen noch potenziert. Bei<br />
einem schichtübergreifenden Weichteildefekt am Knie, der komplikationslos<br />
durch eine gestielten Lappen gedeckt werden kann, ergeben sich,<br />
je nach Hauptdiagnose, Kostengewichte von 0,713 (2880,00 €) bis 1,67<br />
(4902,75 €). Bei der Therapie mit einer freien Lappenplastik bei einem<br />
Patienten mit schweren Nebendiagnosen liegt die Spanne der Kostengewichte<br />
zwischen 3,422 (10046,24 €) und 7,494 (22000,74 €). Im Vortrag<br />
werden die Argumentation des Krankenhaus und des MDK für die<br />
verschiedenen Hauptdiagnosen dargestellt und unter Berücksichtigung<br />
der geltenden Kodierrichtlinien und der SEG-Empfehlungen des MDK<br />
diskutiert. Es werden anhand von Beispielkodierungen mit den Hauptdiagnosen<br />
T81.4, T81.8, L98.8 und M79.8xy die verschieden DRG und<br />
den Erlös demonstriert. Ziel ist es, eine Kodierung in Abhängigkeit von<br />
der Defekttiefe zu erreichen, soweit nicht anders in den Kodierrichtlinien<br />
vorgeschrieben. Nur so kann im gültigen ICD- und DRG-System eine<br />
„aufwandgerechte Vergütung“ abgebildet werden.<br />
V146 L Ordnungsgemäße Abrechnung von<br />
Verbrennungsverletzungen und deren Folgen<br />
Hellmich S, Frank S, Lehnhardt M, Megerle K<br />
BG-Unfallklinik Ludwigshafen<br />
Die Einführung der DRG-Abrechnung für Krankenhausleistungen im<br />
Jahr 2003 in Deutschland sollte ein aufwandgerechteres und wirtschaftlicheres<br />
System zum Ziel haben. In der Tat müssen jedoch jährlich Veränderungen<br />
vorgenommen werden und gerade im Bereich der Verbrennungsmedizin<br />
ist die Realität von einer aufwandgerechten Abbildung<br />
weit entfernt. Ein zusätzlicher, spürbar negativer Effekt der DRG-Einführung<br />
ist das Prüfverhalten der Krankenkassen, der einen massiven<br />
Anstieg von MDK-Anfragen zur Folge hatte. Bezüglich der Kodierung<br />
von Korrekturoperationen im Rahmen der Verbrennungsbehandlung<br />
kommt es regelmäßig zu Differenzen zwischen dem MDK und den behandelnden<br />
Ärzten.<br />
Material und Methoden: Von Januar 2005 bis August 2009 wurden in unserer<br />
Klinik 121 MDK-Anfragen von Fällen mit einer Y-DRG bearbeitet.<br />
Es handelte sich in 65 Fällen um die Erstversorgung einer Verbrennung<br />
und in 56 Fällen um Korrekturoperationen im Rahmen der Verbrennungsbehandlung.<br />
Wir vertreten die Argumentation, dass auch bei Sekundäreingriffen<br />
nach Verbrennung der Kode der „frischen“ Verbrennung<br />
aus T20–T32 als Hauptdiagnose zur Anwendung kommen muss<br />
und keinesfalls der Kode L90.5 „Narbe und Fibrose“ der Haut gewählt<br />
werden darf. Wir beziehen uns auf die deutsche Kodierrichtlinie DKR<br />
D005d „Folgezustände und geplante Folgeeingriffe“. Durch diese Vorgehensweise<br />
wird bei den Korrektureingriffen eine Y-DRG generiert, die<br />
in der Regel ein höheres Relativgewicht aufweist als die Abrechnung einer<br />
„Narbe und Fibrose der Haut“. Im August 2009 wurde in unserem<br />
Haus eine Stichprobenprüfung nach § 17c KHG durchgeführt, bei der<br />
ausschließlich Y-DRG (ohne Beatmung) Prüfgegenstand waren.<br />
Ergebnisse: In 59 % der Fälle (33/56) ist der MDK nach schriftlichen Gutachten<br />
oder Vorortbegehungen der dargestellten Argumentation gefolgt.<br />
In 19 Fällen endete die Begutachtung der Wahl der Hauptdiagnose im<br />
Dissens. Jedoch wurden keine Rechnungen zurückgefordert oder verrechnet.<br />
Einige dieser Episoden sind bereits verjährt und wir werten<br />
dies als indirekte Anerkennung unserer Argumentation. In 4 Fällen<br />
(7 %) konnte keine Einigung erreicht werden und die Gelder wurden<br />
durch die Kassen nicht bezahlt. Die Stichprobenprüfung nach § 17c<br />
57