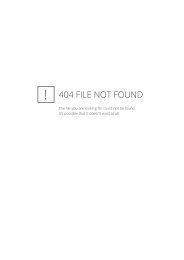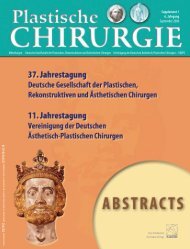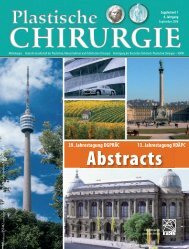Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Abstracts<br />
auf. Durch eine weitgehend nebenwirkungsfreie Dauermedikation mit<br />
Propranolol 2 mg/kg KG kann nicht nur ein Sistieren des Wachstums<br />
sondern sogar eine Regression kindlicher Hämangiome erzielt werden.<br />
Durch die zu erreichende massive Volumenreduktion und verminderte<br />
Blutungsneigung wird eine frühzeitigere, umfassendere sowie komplikationsärmere<br />
plastisch chirurgische Therapie möglich. Als Erklärung für<br />
die gute therapeutische Wirksamkeit von Propranolol könnte die induzierte<br />
Vasokonstriktion und abfallende Expression von VEGF (Vascular<br />
endothelial growth factor) und FGF (Fibroblast growth factor) angesehen<br />
werden. Weitere Studien werden die optimale Dosierung und Dauer<br />
sowie den günstigsten Zeitpunkt des Therapiebeginns klären müssen.<br />
Im Gegensatz zu den bereits veröffentlichten Fallberichten konnten wir<br />
auch ein gutes Ansprechen von Hämangiomen auf Propranolol nach<br />
Vollendung des 12. Lebensmonats zeigen.<br />
P35 L Kutanes Angiosarkom –<br />
Fallbericht und Literaturübersicht<br />
Altayli Z, Heinrich C, Exner K<br />
Markus-Krankenhaus Frankfurt am Main<br />
Das kutane Angiosarkom ist ein seltener vaskulärer Tumor, dessen Häufigkeit<br />
1 % aller Sarkome beträgt. Der Tumor nimmt seinen Ursprung<br />
aus Endothelzellen und tritt überwiegend bei älteren männlichen Patienten<br />
auf. Die äußere Manifestation ist so unterschiedlich und variabel,<br />
dass es häufig als Hämatom, Angioödem oder rosazeaartige Dermatitis<br />
fehldiagnostiziert wird.<br />
Material und Methoden: Ein 78jähriger Patient stellte sich mit einer hämatomartigen<br />
Veränderung der Kalotte auswärtig vor. Anamnestisch<br />
gab er eine Schädelprellung 4 Monate zuvor an, seitdem sei der Befund<br />
größenprogredient. Auswärtig wurde die Veränderung exzidiert, der<br />
Defekt mit einer lokalen Verschiebelappenplastik gedeckt. Nach Vorliegen<br />
der Histologie eines high-grade Angiosarkoms wurde der Patient<br />
uns zur Nachresektion und Defektdeckung vorgestellt. Die Nachresektion<br />
bei uns ergab weitere Infiltration durch Low-grade-Komponente.<br />
Bei ausreichendem Sicherheitsabstandes konnte der Defekt schließlich<br />
durch einen freien M.-latissimus-dorsi-Lappen erfolgen. Als Anschlussgefäße<br />
dienten die A. und V. temporalis superficialis. Die Einheilung<br />
war unproblematisch. Unter kurativem Ansatz wurde der Patient mit<br />
60 Gy bestrahlt. Eine Nachsorge erfolgte 6/12 Monate postoperativ<br />
mittels Inspektion, Fotodokumentation, CCT, Röntgen des Thorax und<br />
Sonographie der Halslymphknoten. Nach 6 Monaten zeigten sich Teleangiektasien<br />
und dunkle Induration der Haut, so dass rasterartig Proben<br />
entnommen wurden, um ein Rezidiv auszuschließen. Der Verdacht<br />
bestätigte sich nicht.<br />
Ergebnisse: Aus der Literatur ist zu entnehmen, dass unterschiedliche<br />
Formen der Angiosarkome existieren. Besondere Aufmerksamkeit sollte<br />
primären Angiosarkomen, lymphödemassoziierten Angiosarkomen und<br />
Angiosarkomen der Brust nach Radiatio gelten. Sarkome der Brust nach<br />
Radiatio sind Aufgrund der zunehmenden Zahl der Mammakarzinome<br />
immer häufiger zu finden. Als mögliche Risikofaktoren für die Entstehung<br />
der Angiosarkome hingegen gelten der Literatur nach vorhergehende<br />
Traumata, Lymphödeme und Bestrahlung. Histopathologisch<br />
sind high-grade und low-grade Komponenten und multifokales Auftreten,<br />
wobei der Übergang als fließend beschrieben wird. Das Kernstück<br />
der Therapie ist die Chirurgie, Studien belegten die signifikante Reduktion<br />
der Sterblichkeit durch eine postoperative adjuvante Radiatio. Trotzdem<br />
beträgt die 5-JÜR 4 %, im Median etwa 18–28 Monate.<br />
Diskussion: Angiosarkome treten in unterschiedlichsten Morphologien<br />
auf. Differenzialdiagnostisch sollte bei nicht heilenden, größenprogredienten<br />
hämatomartigen Veränderungen an ein Angiosarkom gedacht<br />
werden. Wir behandelten in den letzten 5 Jahren 5 Patienten mit An-<br />
giosarkomen und fanden, wie in der Literatur beschrieben, jeweils unterschiedliche<br />
Morphologien vor, über die wir vergleichend berichten<br />
werden.<br />
P36 L Charakteristische Merkmale und Unterschiede<br />
der nekrotisierenden Fasziitis und der gasbildenden<br />
Myonekrose<br />
Tilkorn D-J, Ring A, Fehmer T, Hauser J, Goertz O, Stricker I, Roetman B, Steinau H-U<br />
BG-Universitätsklinikum Bergmannsheil Bochum<br />
Sowohl die nekrotisiernde Fasziitis (NF) als auch die gasbildende Myonekrose<br />
(GMN) gehören zu den seltenen jedoch schweren und oft<br />
lebensbedrohlichen Weichgewebinfektionen. Sie teilen eingige Gemeinsamkeiten<br />
bezüglich der klinischen Symptomatik und des klinischen<br />
Verlaufs. Sie sind schnell progrediente Weichgewebsinfektionen mit einer<br />
ernsten Prognose und einer hohen Mortalität. Ziele der Studie ist es<br />
klinische Unterschiede dieser Infektionen welche die Therapie beeinflussen<br />
hervorzuheben.<br />
Methode: Die Daten der Patienten mit schweren Weichgewebsinfektion<br />
die in der Zeit von 2005 bis 2009 behandelt wurden, wurden retrospektiv<br />
analysiert. Es wurden 30 Patienten mit nekrotisiernder Fasziitis und<br />
6 Patienten mit gasbbildener Myonekrose identifiziert. Der LRINEC-<br />
Score wurde erfasst sowie die histologischen Präparate, CT- und MRT-<br />
Bildgebung beurteilt. Unterschiede bezüglch des klinischen Verlaufs, der<br />
Dauer des Krankenhausaufenthaltes, der chirurgischen Interventionen<br />
und der Nebenerkrankungen wurden evaluiert.<br />
Ergebnisse: Die nekrotisiernde Fasziitis entwickelte sich in den meisten<br />
Fällen auf Grund von minimalen Hautläsionen. Bei den agsbildenden<br />
Myonekrosen war bei 3 von 6 Patienten eine bis zur Einweisung in unsere<br />
Klinik verborgen gebliebene intraabdominelle Infektionsquelle ursächlich.<br />
Die GMN war mit einem erhöhten LRINEC-Score, einer höheren<br />
Mortalität, einem größeren chirurgischen Interventionsbedarf sowie<br />
einer längeren Krankenhausaufenthaltsdauer vergesellschaftet.<br />
P37 L Diffuse Melanosis cutis bei metastasiertem<br />
malignen Melanom – eine Rarität<br />
Krüss Ch, Bultmann H, Hallermann C, Krause-Bergmann A<br />
Fachklinik Hornheide, Münster<br />
Poster | Donnerstag | 16.9.<strong>2010</strong><br />
Das maligne Melanom ist ein bösartiger Tumor, der vom melanozytären<br />
Zellsystem ausgeht und sich überwiegend an der Haut manifestiert.<br />
Im Verhältnis zur Tumormasse besteht eine frühe Tendenz zur Metastasierung<br />
und damit eine ungünstige Prognose. Die Inzidenz nimmt in<br />
weißen Bevölkerungsgruppen weltweit zu und ist in Mitteleuropa seit<br />
dem Beginn der 1970er Jahre von 3 Fällen auf aktuell 10–12 Neuerkrankungen/100<br />
000 Einwohner gestiegen. Durch Aufklärungsprogramme<br />
und Früherkennungsmaßnahmen konnte trotz deutlicher Zunahme der<br />
Erkrankungen die Sterberate bisher weitestgehend konstant gehalten<br />
werden. Ca. 90 % aller malignen Melanome kommen derzeit als Primärtumor<br />
ohne erkennbare Metastasierung zur ersten Diagnose. Die tumorspezifische<br />
10-Jahres-Überlebensrate im Gesamtkollektiv beträgt 75–<br />
80 %. Bei Patienten mit klinisch manifesten Lymphknotenmetastasen<br />
beträgt die 10-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit 20–40 %. Bei Fernmetastasierung<br />
ist die Prognose zumeist infaust. Die media-ne Überlebenszeit<br />
ohne Behandlung beträgt nur 6–9 Monate. Die Melanosis cutis<br />
ist ein äußerst selten vorkommendes Erscheinungsbild des metastasierten<br />
malignen Melanoms und tritt erst im fortgeschrittenen Tumorstadium<br />
auf. Etwa 30 Fälle sind in der englischsprachigen Literatur bekannt.<br />
Die Prognose der betroffenen Patienten ist sehr schlecht mit einer Über-<br />
86 Plastische Chirurgie 10 (Suppl. 1): 86 (<strong>2010</strong>)