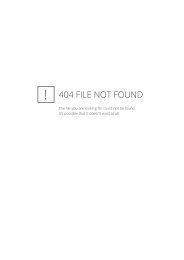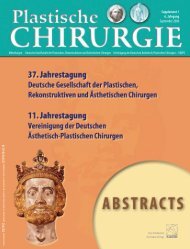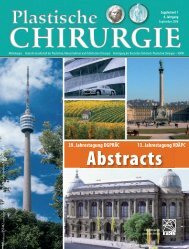Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Vorträge | Freitag | 17.9.<strong>2010</strong><br />
Hypothese: Eine solche Beeinträchtigung lässt sich umgehen, indem man<br />
intraoperativ diese Falte auflöst und so einen harmonischen, glatten<br />
Übergang zwischen Axilla und Brust schafft. Dazu ist die genaue Kenntnis<br />
der Strukturen, die zur Bildung dieser Falte führen, notwendig.<br />
Methoden: Bei Patientinnen mit Indikation zur Mammareduktionsplastik<br />
fielen bei der präoperativen Planung Einziehung der Haut präaxillär<br />
im kranio-lateralen Bereich der Brust auf. Bei den operativen Eingriffen<br />
konnten durch Präparation entlang der Faszie des M. pectoralis major<br />
nach kranial bindegewebige Fasern dargestellt und durchtrennt werden.<br />
Durch die nachfolgende Kranialtransposition von Brustdrüsenanteilen<br />
in den oberen äußeren Quadranten wird ein Niveauausgleich erzielt.<br />
Ausgehend von diesen Beobachtungen erfolgten gezielte anatomische<br />
Studien zur Erkundung der Strukturen die zu der Bildung der beobachteten<br />
Falte führen. In einem ersten Schritt wurde bei neun Leichen der<br />
ventrale Anteil des Thorax präpariert. In einem zweiten Schritt wurde<br />
die komplette linke Thoraxhälfte einer Leiche plastiniert. Hierzu wurde<br />
eine Leiche mit bereits makroskopisch kräftig erkennbaren Bandapparat<br />
gewählt. Die Plastination erfolgte in der Technik von Hagens in den<br />
üblichen Schritten. Das Plastinat wurde mit einer Diamantdrahtsäge in<br />
196 Schnitte mit einer Dicke von 500 µm zerlegt, die Schnitte der Technik<br />
nach Laczkó und Lévai folgend gefärbt und zwischen Glasscheiben<br />
erneut in Harz eingebettet.<br />
Ergebnisse: Bei der Präparation zeigten sich starke Faserverläufe vom kranialen<br />
Teil des M. pectoralis major sowie vom lateralen Teil des M. pectoralis<br />
minor zur präaxillären Falte. Die Fasern vom M. pectoralis minor<br />
zogen hierbei um den lateralen Rand des M. pectoralis major herum und<br />
inserierten dann fächerförmig in der Haut im Verlauf der präaxillären<br />
Falte. In den gefärbten Scheibenplastinaten sind kollagene Fasern zu erkennen,<br />
die das subkutane Gewebe durchziehen und im Chorium inserieren.<br />
Die Fasern, die im unteren Bereich der Falte inserieren, ziehen in<br />
einem Bogen zur Oberseite des M. pectoralis major sowie zwischen die<br />
Mm. pectoralis major et minor. Die Fasern sind untereinander verbunden,<br />
so dass eine netzartige Struktur entsteht, deren Mittelpunkt in der<br />
Haut im Bereich der präaxillären Falte liegt.<br />
Fazit: Wie bereits intraoperativ beobachtet, lassen sich bei der Präparation<br />
Faserzüge darstellen, die ausgehend von den Mm. pectoralis major<br />
et minor zu der beschriebenen präaxillären Falte ziehen. Die Funktion<br />
der Fasern bei der Entstehung der Falte lässt sich am Präparat sehr gut<br />
nachvollziehen. Mit der genauen Identifizierung der zur Bildung der<br />
präaxillären Falte führenden Strukturen lassen sich diese intraoperativ<br />
gezielt aufsuchen und auflösen. Das operative Ergebnis formverändernder<br />
Eingriffe an der Brust, zum Beispiel bei Mammareduktionsplastiken,<br />
lässt sich hierdurch ästhetisch verbessern.<br />
V73 L breastlift von axillär oder periareolär<br />
Hellers J, Graf von Finckenstein J<br />
Kreiskrankenhaus Starnberg<br />
Die Diagnose Brustptosis stellt sich häufig in der ästhetischen Chirurgie.<br />
Die Standardtherapie ist die Mastopexie mit Narben periareolär sowie<br />
einer vertikalen Narbe von der Areola bis zur Submammärfalte. Bei<br />
kleinen Brüsten mit wenig Volumen ist des Weiteren häufig eine Augmentation<br />
mittels Implantat notwendig um das gewünschte Ergebnis zu<br />
erzielen. Viele Patienten scheuen die Narben und die Implantate. Aus<br />
diesem Grund haben wir eine neue narbensparende Methode entwickelt<br />
um eine moderate Ptose (Einteilung nach Regnault) zu korrigieren.<br />
Methoden: Von Mai 2007 bis Dezember 2009 wurden 20 Patientinnen mit<br />
Brustptosis Grad I und II mit unserer Methode behandelt. Der Zugang<br />
erfolgte entweder axillär oder semizirkulär an der kranialen Areola. Anschließend<br />
wurde die Brustdrüse vom Unterhautfettgewebe gelöst und<br />
an der Pektoralisfaszie nach kranial in Höhe der zweiten Rippe fixiert<br />
Plastische Chirurgie 10 (Suppl. 1): 31 (<strong>2010</strong>)<br />
Abstracts<br />
mit dem Ziel die Brustdrüse in den oberen Quadranten übereinander zu<br />
legen um dort mehr Gewebefülle zu erhalten.<br />
Ergebnisse: Bei 9 Patientinnen wurde der axilläre Zugang gewählt, in den<br />
anderen 11 Fällen der kraniale semizirkuläre Schnitt. Die Operation<br />
wurde je nach Wunsch in Allgemeinnarkose oder Tumeszenzanästhesie<br />
durchgeführt. Der Nachbeobachtungszeitraum betrug mindestens 6<br />
(Mittel 14) Monate. Bei allen Patientinnen konnte die Brustform und<br />
die Ptosis verbessert werden. Die Areola wurde durchschnittlich um 2<br />
cm nach cranial versetzt. Eine revisionspflichtige Blutung unmittelbar<br />
postoperativ aus dem subdermalen Gefäßplexus wurde bei 2 Patientinnen<br />
beobachtet.<br />
Fazit: Das periareoläre oder axilläre Breastlift stellt ein weiteres Werkzeug<br />
in der Behandlung der moderaten Brustptosis dar. In einigen Fällen<br />
wirkt die Brust wegen größerer Gewebedichte auf engerem Raum<br />
kleiner, obwohl kein Gewebe entnommen wurde. Eine anschließende<br />
Fetttransplantation kann in diesen Fällen die Kontur und das Volumen<br />
verbessern.<br />
V74 L Medial gestielte Mammareduktionsplastik<br />
basierend auf dem horizontalen septum nach Würinger<br />
Ryssel H, Germann G, Lehnhardt M<br />
BG-Unfallklinik Ludwigshafen<br />
Mammareduktionsplastiken führen speziell bei Patienten mit ausgeprägter<br />
Makromastie zu Problemen der MAk-Durchblutung und Sensibilität.<br />
Während der letzten 30 Monate haben wir 42 septum-basierte Mammareduktionsplastiken<br />
durchgeführt. Ziel dieses Vortrages ist es, die anatomischen<br />
Grundlagen der septum-basierten Mammareduktionsplastik<br />
darzustellen und unsere Erfahrungen aus den letzten 30 Monaten mit<br />
dieser Technik erläutern. Diese Technik verwendet einen medialen Pedikel,<br />
der auf dem von Würinger beschriebenen horizontalen Septum basiert<br />
ist. Dieses Septum ist Leitstruktur für die nervale und die vaskuläre<br />
Versorgung des Mamillen-Areolenkomplexes. Die mittlere Distanz zwischen<br />
Jugulum und Mamillen-Areolenkomplex betrug 33 (24–43) cm.<br />
Das durchschnittliche Resektionsgewicht betrug 684 (484–1320) g. Die<br />
durchschnittliche Nippel-Areolen-Komplex (NAK) Elelevation betrug<br />
9,5 (5–17) cm. Es traten keine Hämatome, MAK-Teil- oder Komplettnekrosen<br />
auf. Umschriebene Wunddehiszenzen am T-Vereinigungspunkt<br />
traten bei 3 Patienten (6 %) auf. Eine sekundäre Narbenrevision war in<br />
2 Fällen (2 %) notwendig. Bei keiner Patientin, die sich einer septumbasierten<br />
Mammareduktionsplastik unterzog kam es zu einer Minderdurchblutung<br />
des Mamillen-Areolen-Komplexes, es kam zu keinerlei<br />
Teil- oder Totalnekrosen im weiteren Verlauf bei subjektiv komplett<br />
erhaltener Sensibilität. Basierend auf dem horizontalen Septum nach<br />
Würinger kann durch die ausgeprägte Vaskularisation eine sehr sichere<br />
Mammareduktion auch mit großem Resektionsgewicht unter Erhalt der<br />
Mamillensensibilität durchgeführt werden. Diese Technik ist sehr sicher<br />
und ist mit einer vereinfachten Pedikelformung verbunden, weiterhin<br />
ist das Modellieren der Brust im Rahmen der Reduktion gut durchzuführen.<br />
V75 L Ergebnisse der modifizierten Lejour-technik bei<br />
brustreduktion und straffung<br />
Hankiss J, Schramm S, Maier M, Kern L<br />
Klinikum Lippe-Lemgo<br />
Verschiedene operative Techniken zur Brustreduktion mit vertikaler<br />
Narbe sind bekannt. Die Methode von Lejour ist weit verbreitet. Verbesserungen<br />
und Modifikationen sind aus der Literatur bekannt. Die<br />
Autoren berichten über die eigene Interpretation der Technik, wobei<br />
31