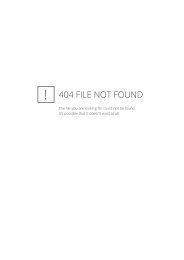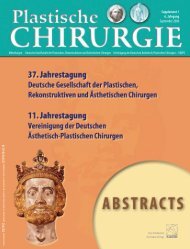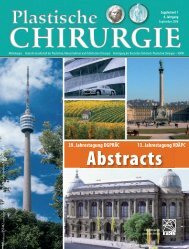Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Supplement 1 10. Jahrgang September 2010 D57442 ... - DGPRÄC
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Vorträge | Donnerstag | 16.9.<strong>2010</strong><br />
geschrittenen Stadium (Tubiana II–IV) die offene partielle Fasziektomie<br />
als etabliertes Verfahren. Jedoch hat in den letzten Jahren die Fasziektomie<br />
in modifizierter Form als perkutane Nadel-Fasziotomie (PNF) stark<br />
an Bedeutung gewonnen.<br />
Hypothese: Die PNF kann nach Berücksichtigung der bisher über 10<br />
Monate erhobenen Ergebnisse gegenüber der offenen Fasziektomie als<br />
gleichwertige operative Therapie betrachtet werden. Für bestimmte Patientengruppen,<br />
insbesondere Altersgruppen stellt die PNF eine risikoärmere<br />
Alternative dar.<br />
Methode: Während bei der Fasziektomie das Dupuytrensche Gewebe in<br />
einer offenen Operation weitestgehend reserziert wird, erfolgt bei der<br />
PNF lediglich eine perkutane Perforation der Dupuytren-Stränge. In einer<br />
laufenden prospektiven Studie (n=40) werden beide Methoden gegenübergestellt<br />
und die Ergebnisse bezüglich intraoperativer Komplikationen,<br />
postoperativer Funktion, Wundheilung und Wiederherstellung<br />
der Arbeitsfähigkeit verglichen. Es werden nur primäre Dupuytrensche<br />
Kontrakturen Grad II-III in die Studie aufgenommen. Des Weiteren wird<br />
der Langzeitverlauf bezüglich des Wiederauftretens der Kontraktur beobachtet.<br />
Ergebnisse: Erste Ergebnisse nach 10 Monaten zeigen für die PNF (n=20)<br />
gleiche postoperative funktionelle Resultate gegenüber der Fasziektomie<br />
(n=20), bei bis dahin keinen intraoperativen Komplikationen und keinen<br />
Wundheilungsstörungen. Zudem ist die Zeit der Arbeitsunfähigkeit<br />
kürzer als bei der offenen Resektion. Die Ergebnisse bezüglich des Wiederauftretens<br />
bleiben abzuwarten.<br />
Fazit: Die PNF stellt ein einfaches und risikoarmes Verfahren zur Therapie<br />
strangförmig vorliegender Dupuytrenscher Kontrakturen dar.<br />
Nach ersten Ergebnissen erscheint sie der Fasziektomie insbesondere<br />
bei entsprechender Indikationsstellung für spezielle Patientengruppen<br />
als gleichwertig. Die entscheidende Frage des Wiederauftretens der<br />
Kontraktur kann derzeit noch nicht abschließend beantwortet werden.<br />
Nach der aktuellen Literatur lässt sich jedoch eine gesteigerte Häufigkeit<br />
vermuten. Weiter muss postuliert werden, dass die PNF im Rahmen der<br />
möglichen Komplikations-beherrschung dem handchirurgisch versierten<br />
Operateur überlassen bleiben sollte.<br />
Verbrennung/Narbe 1<br />
Donnerstag, 9:00–10:00, Saal 4<br />
V7 L Diagnostik und Management der<br />
Heparininduzierten thrombozytopenie (HIt) in<br />
deutschsprachigen Verbrennungszentren<br />
Busche M, Knobloch K, Vogt PM, Rennekampff H-O<br />
Medizinische Hochschule Hannover<br />
Die HIT II ist eine verzögert einsetzende und potentiell lebensbedrohliche<br />
Komplikation der antikoagulativen Therapie mit Heparin.<br />
Hypothese: Im Rahmen einer Befragung von deutschsprachigen Verbrennungszentren<br />
sollte die antikoagulative Therapie mit Heparin, die Inzidenz<br />
von tiefen Beinvenenthrombosen (TBVT) und die Inzidenz, sowie<br />
Diagnostik und Management der HIT evaluiert werden.<br />
Patienten und Methoden: Multiple-choice Fragebögen wurden an alle<br />
deutschsprachigen Verbrennungszentren in Deutschland, Österreich<br />
und der Schweiz versandt. Nachgefragt wurden: Anzahl Verbrennungspatienten<br />
(>18 Jahre) und Inzidenz der HIT bei Brandverletzten im<br />
Jahr 2008, Screening und Diagnostik der HIT, Verwendung und Steuerung<br />
von Ausweichpräparaten zur Antikoagulation, Inzidenz von tiefen<br />
Beinvenenthrombosen bei Brandverletzten und Indikation zur Thromboseprophylaxe<br />
mit fraktioniertem Heparin (FH) s.c. und unfraktioniertem<br />
Heparin (UFH) i.v.<br />
Plastische Chirurgie 10 (Suppl. 1): 7 (<strong>2010</strong>)<br />
Abstracts<br />
Ergebnisse: Die Rücklaufrate der verschickten Fragebögen betrug 84 %<br />
(21/25). Das hierdurch erfasste Patientenkollektiv (>18 Jahre) für das<br />
Jahr 2008 in den 21 Zentren betrug 1611 intensivpflichtige Verbrennungspatienten<br />
(>18 Jahre). Von diesen Patienten hatten 23 eine nachgewiesene<br />
HIT (1,4 %). TBVT traten mit einer Häufigkeit von 1,1 %<br />
auf. Eine standardmäßige Antikoagulation mit FH s.c. erfolgte in 40 %<br />
(8/20) aller Verbrennungszentren, während 10 % (2/20) standardmäßig<br />
UFH i.v. verwendeten. 15 % (3/20) aller Verbrennungszentren stellten<br />
die Indikation zur Verwendung von FH oder UFH anhand der Intubation<br />
des Patienten (bei Intubation UFH i.v.) und 5 % (1/20) anhand der<br />
Intubation und des TBSA-Wertes (bei TBSA > 10 % UFH i.v.). 30 %<br />
(6/20) der Zentren zeigten keinen erkennbaren Standard bei der Verwendung<br />
von FH oder UFH. Nur in einem Zentrum wurde bei Aufnahme<br />
ein HIT-Screening durchgeführt. Das bei HIT am meisten verwendete<br />
Ausweichpräparat zur Antikoagulation ist Agatroban (52 %). Die<br />
geringste Inzidenz der HIT mit 0,2 % bestand in Verbrennungszentren,<br />
die standardmäßig FH s.c. verwendeten. Zentren, die standardmäßig<br />
UFH i.v. verwendeten, hatten die höchste HIT-Inzidenz (2,7 %). In Zentren,<br />
die die Therapie mit FH oder UFH abhängig von der Intubation<br />
und/oder nach TBSA des Patienten verwendeten, betrug die Inzidenz<br />
der HIT 2,5 % und in Zentren, die keinen erkennbaren Standard bei der<br />
Verwendung von FH und UFH hatten, 1,7 %. Eine zur HIT-Inzidenz<br />
vergleichbare Verteilung ergab sich für die Inzidenz von tiefen Beinvenenthrombosen<br />
(TBVT). Verbrennungszentren, die standardmäßig FH<br />
s.c. verwendeten, hatten eine geringe Inzidenz an TBVT von 0,9 %,<br />
während die höchste Inzidenz von TBVT mit 3,8 % in Zentren gefunden<br />
wurde, die standardmäßig UFH i.v. verwendeten.<br />
Fazit: Die geringste Inzidenz an HIT (0,2 %) und TBVT (0,9 %) wurde<br />
in den Verbrennungszentren gefunden, die eine standardmäßige Antikoagulation<br />
mit FH s.c. verwendeten, während die standardmäßige Verwendung<br />
von UFH i.v. mit den höchsten HIT- und Thrombose-Raten<br />
verbunden war (2,7 und 3,8 %). Prospektive, randomisierte Studien sind<br />
erforderlich, um die Überlegenheit einer standardmäßigen Verwendung<br />
von FH s.c. gegenüber UFH i.v. in Verbrennungszentren zu belegen.<br />
V8 L Immunologische Verläufe bei der sepsisentstehung<br />
nach Verbrennungstrauma – Interleukin-10 ein neuer<br />
prognostischer Marker für die Patientenmortalität?<br />
Eppstein RJ, Stromps JP, Aengeneyndt S, Suschek CV, Pallua N<br />
Universitätsklinikum Aachen<br />
Durch die Fortschritte in der Behandlung von Verbrennungspatienten<br />
konnte die Mortalität nach thermischem Trauma in der Vergangenheit<br />
deutlich reduziert werden. Neben dem Ausmaß der verbrannten Körperoberfläche<br />
(VKOF), dem Patientenalter und einem zusätzlichen Inhalationstrauma<br />
ist die Entwicklung einer Sepsis einer der entscheidenden<br />
Faktoren hinsichtlich der Mortalität nach einem Verbrennungstrauma.<br />
Innerhalb der letzten Jahrzehnte konnten die immunologischen Reaktionen<br />
nach einem thermischen Trauma in Hinblick auf die beteiligten<br />
Mediatorsubstanzen zunehmend aufgeklärt werden. Die zeitlichen Verläufe<br />
und Interaktionen von Interleukinen, Lymphokine und weiteren<br />
Entzündungsmediatoren, die nach einem thermischen Trauma zu einem<br />
Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) und einer Sepsis<br />
führen können, sind derzeit jedoch noch nicht ausreichend geklärt.<br />
Material und Methodik: Innerhalb der letzten 6 Monate wurden 11<br />
Patienten (n=11) untersucht, die nach einem thermischen Trauma in<br />
unserem Verbrennungszentrum aufgenommen wurden. Einschlusskriterien<br />
für diese klinische Studie waren eine Verbrennung Grad IIa bis<br />
III von mehr als 10 % der Körperoberfläche sowie ein Lebensalter >15<br />
Jahren. Ein weiteres entscheidendes Kriterium war, dass zwischen dem<br />
7