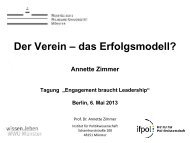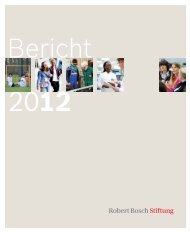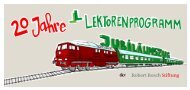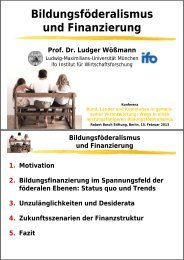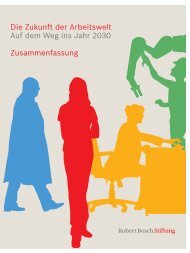Bericht der Kommission »Familie und demographischer Wandel
Bericht der Kommission »Familie und demographischer Wandel
Bericht der Kommission »Familie und demographischer Wandel
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
18 19 I. Die Bedeutung <strong>der</strong> kleinen Lebenskreise<br />
allen seinen Bürgern die soziale Sicherheit<br />
gewähren müsse.«<br />
Derartigen Bestrebungen treten die Autoren<br />
<strong>der</strong> Denkschrift mit <strong>der</strong> Feststellung entgegen,<br />
»<strong>der</strong> Plan, alle Menschen ohne Ausnahme,<br />
auch jene, die sich selbst helfen<br />
können, zwangsweise in eine staatlich angeordnete<br />
soziale Sicherheit einzubeziehen«,<br />
sei mit dem Subsidiaritätsprinzip unvereinbar.<br />
Er gefährde auch den Staat, denn es<br />
verleite die Menschen dazu, dem Staat<br />
lediglich mit For<strong>der</strong>ungen gegenüberzutreten.<br />
Die im Solidaritätsprinzip verankerte<br />
wechselseitige Bindung <strong>und</strong> Rückbindung<br />
zwischen dem Einzelnen <strong>und</strong> dem Staat<br />
werde dadurch gestört. Die Verschiebung<br />
<strong>der</strong> Verfügungsgewalt <strong>und</strong> <strong>der</strong> Verantwortung<br />
zugunsten des Staates dürfe folglich<br />
nicht so weit getrieben werden, dass <strong>der</strong><br />
Bereich <strong>der</strong> persönlichen Freiheit <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
Raum <strong>der</strong> Verantwortung von Individuen<br />
<strong>und</strong> Familien unerträglich eingeschränkt<br />
werde.<br />
Die Entscheidung zwischen den beiden<br />
Konzepten fällte letztlich <strong>der</strong> B<strong>und</strong>estag im<br />
Jahre 1957 mit seinen Beschlüssen zur<br />
Erneuerung <strong>der</strong> sozialen Systeme nach<br />
Gründung <strong>der</strong> B<strong>und</strong>esrepublik. Zwar entsprach<br />
das Konzept, die neue soziale Ordnung<br />
nach den Gr<strong>und</strong>sätzen <strong>der</strong> Subsidiarität<br />
zu gestalten <strong>und</strong> institutionelle Machtkonzentrationen<br />
zu vermeiden, durchaus<br />
dem Gedankengut <strong>der</strong> Union <strong>und</strong> fand auch<br />
in <strong>der</strong> SPD Befürworter. Gleichwohl wurde<br />
es im Zuge <strong>der</strong> Neuordnung nicht weiter<br />
verfolgt. Der Gedanke, mit Hilfe einer<br />
umfassenden Sozialpolitik <strong>der</strong> Befriedung<br />
des Volkes zu dienen <strong>und</strong> sein Vertrauen in<br />
die neue, noch nicht gefestigte demokratische<br />
Ordnung zu stärken, war zu verlockend.<br />
Er erschien erfolgversprechen<strong>der</strong> als<br />
eine Sozialpolitik, die primär auf die Fähigkeit<br />
<strong>der</strong> Bürger vertraute, in erster Linie<br />
Verantwortung für sich selbst zu übernehmen,<br />
<strong>und</strong> dem Staat <strong>und</strong> seinen Sozialsystemen<br />
eine subsidiäre Rolle zuwies. Zudem<br />
erschienen die Erfahrungen aus <strong>der</strong> Katastrophe<br />
des Zweiten Weltkrieges noch zu<br />
lebendig <strong>und</strong> die Belastbarkeit <strong>der</strong> jungen<br />
demokratischen Ordnung noch zu wenig<br />
erprobt, als dass man die soziale Sicherheit<br />
vorrangig <strong>der</strong> Verantwortung <strong>der</strong> Bürger<br />
selbst anvertrauen wollte.<br />
Hinzu kam, dass sich die Institutionen <strong>der</strong><br />
Sozialpolitik Mitte <strong>der</strong> 1950er Jahre bereits<br />
zu Machtgebilden verfestigt hatten. Sie standen<br />
bereit, eine umfassende Sozialpolitik<br />
für alle wirtschaftlich <strong>und</strong> sozial Abhängigen<br />
zu verwirklichen: praktisch für die<br />
große Mehrheit <strong>der</strong> Bevölkerung.<br />
Damit scheiterte <strong>der</strong> Versuch, die Ordnung<br />
<strong>der</strong> Wirtschaft <strong>und</strong> die Ordnung des Sozialen<br />
nach kompatiblen ordnungspolitischen<br />
Gr<strong>und</strong>sätzen zu gestalten. Wertgeb<strong>und</strong>ener<br />
Wettbewerb in offenen Märkten <strong>und</strong> eine<br />
umfassende staatliche Sozialpolitik waren<br />
<strong>und</strong> sind ordnungspolitisch nur begrenzt<br />
kompatibel. Denn sie orientieren sich letztlich<br />
an zwei unterschiedlichen Einschätzungen<br />
bürgerschaftlicher Fähigkeiten <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
Bereitschaft zur Eigenverantwortung. Seitdem<br />
beherrscht <strong>der</strong> Dualismus von Wirtschafts-<br />
<strong>und</strong> Sozialpolitik die Entwicklung<br />
<strong>der</strong> Wirtschafts- <strong>und</strong> Sozialordnung <strong>und</strong><br />
prägt die politische Entwicklung in Deutschland.<br />
Sein Anspruch, eine umfassende Sozialpolitik<br />
zu verwirklichen, hin<strong>der</strong>t den Sozialstaat<br />
daran, seine Sozialpolitik allein aus Gründen<br />
<strong>der</strong> Gerechtigkeit <strong>und</strong> Solidarität zu<br />
begrenzen. Denn sein Auftrag beinhaltet bis<br />
heute nach wohl herrschen<strong>der</strong> Meinung<br />
stets auch, das Vertrauen <strong>der</strong> großen Mehrheit<br />
<strong>der</strong> Bevölkerung in die demokratische<br />
Ordnung zu stärken <strong>und</strong> so dem sozialen<br />
Frieden zu dienen. Ob dies gelingt, lässt<br />
sich jedoch nicht nur nach Kriterien <strong>der</strong><br />
sozialen Gerechtigkeit beurteilen, zumal es<br />
sich bei ihnen um relative Maßstäbe handelt.<br />
Auch eine wohlhabende Gesellschaft<br />
kann durch Argumente <strong>der</strong> Verteilungsun-