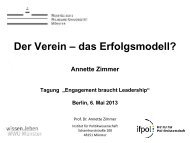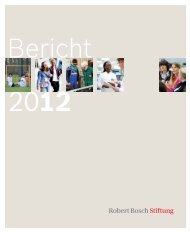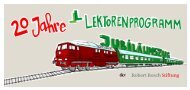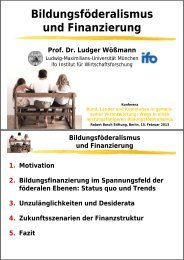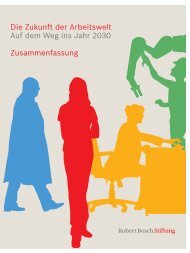Bericht der Kommission »Familie und demographischer Wandel
Bericht der Kommission »Familie und demographischer Wandel
Bericht der Kommission »Familie und demographischer Wandel
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
66 67<br />
IV. Kindeswohl <strong>und</strong> Wohl <strong>der</strong> Älteren<br />
1 Subsidiarität <strong>und</strong> globale Welt<br />
Die Gr<strong>und</strong>lagen des Prinzips Subsidiarität<br />
haben wir bereits in Teil I dargelegt. Dabei<br />
wurde deutlich, dass es sich im Kern um die<br />
Entscheidung einer Machtfrage handelt. Es<br />
geht um das Spannungsverhältnis zwischen<br />
bürgerlicher Freiheit, die eigenen Angelegenheiten<br />
verantwortlich selbst <strong>und</strong> frei von<br />
staatlicher Einmischung zu ordnen, <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
inhaltlichen Bestimmung des Rechts <strong>der</strong><br />
staatlichen Macht, in den geschützten Raum<br />
aus Gründen eines höherwertigen Gesamtinteresses<br />
einzugreifen. Im deutschen Wohlfahrtsstaat<br />
obrigkeitlicher Prägung des<br />
19. Jahrhun<strong>der</strong>ts wurde das Eingriffsrecht<br />
des Staates aus dem Anspruch abgeleitet,<br />
die Lebensverhältnisse möglichst aller Menschen<br />
nach einheitlichen Maßstäben zu<br />
regulieren. Die heutigen sozialen Sicherungssysteme,<br />
wie gesetzliche Renten, Pensionen<br />
<strong>und</strong> die Arbeitslosenversicherung,<br />
entstammen dieser Vorstellung ebenso wie<br />
eine möglichst einheitliche Krankenversicherung.<br />
Ihnen allen liegt die Vorstellung<br />
zugr<strong>und</strong>e, vor allem <strong>der</strong> Zentralstaat sei in<br />
<strong>der</strong> Lage, gesellschaftliche Risiken abzusichern<br />
<strong>und</strong> damit auch die individuellen<br />
Lebensrisiken in angemessener Weise abzuwenden.<br />
Diese Sicht <strong>der</strong> Dinge entspricht in <strong>der</strong><br />
wissenschaftlichen Diskussion <strong>der</strong> These<br />
von Putnam, es werde in hoch differenzierten<br />
Gesellschaften immer schwieriger, sich<br />
darauf zu verlassen, dass die Familie, die<br />
Nachbarschaft <strong>und</strong> die Gemeinde die notwendigen<br />
Unterstützungen erbringen könnten,<br />
um das Subsidiaritätsprinzip zu leben.<br />
Mit seiner Argumentation, dass die Menschen<br />
heute nur noch für sich allein leben<br />
(»bowling alone«), steht Putnam nicht allein;<br />
in <strong>der</strong> deutschen Diskussion ist Ulrich Beck<br />
ein prominenter Vertreter dieser Position.<br />
Auch Richard Sennett beschreibt, wie in <strong>der</strong><br />
hoch flexiblen Welt des Kapitalismus feste<br />
Bindungen <strong>und</strong> Beziehungen gar nicht mehr<br />
entwickelt werden können, so dass nur<br />
noch <strong>der</strong> Gesamtstaat <strong>und</strong> die von ihm<br />
getragenen Institutionen in <strong>der</strong> Lage seien,<br />
die Lebensrisiken des Einzelnen zu bewältigen.<br />
Erstaunlich an dieser weltweit geführten<br />
Debatte ist die Tatsache, dass vor allem<br />
deutschsprachige Autoren die These vertreten,<br />
<strong>der</strong> Zentralstaat gebe immer die Strukturen<br />
des individuellen Handelns <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
Beziehungen vor <strong>und</strong> strukturiere damit<br />
auch die privaten Lebensformen <strong>und</strong> die<br />
familiären Bindungen (Alber 1982). Im Kontrast<br />
zu dieser eher deutschen Debatte zeigen<br />
jedoch französische Historiker, etwa<br />
Aries in <strong>der</strong> »Geschichte <strong>der</strong> Familie«, dass<br />
vor allem im 19. Jahrhun<strong>der</strong>t die staatlichen<br />
Institutionen immer wie<strong>der</strong> den Versuch<br />
unternommen haben, das private Leben <strong>der</strong><br />
Bürger möglichst nach ihren Vorstellungen<br />
zu formen.<br />
Das galt nicht nur für die Französische<br />
Revolution, bei <strong>der</strong> sogar die Nachthemden<br />
<strong>der</strong> Bürger revolutionär vorgeschrieben<br />
waren. Der französische Historiker Donzelot<br />
hat in seiner »Ordnung <strong>der</strong> Familie« mit<br />
bewun<strong>der</strong>nswerter Klarheit beschrieben,<br />
wie <strong>der</strong> französische Staat im 19. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
sukzessiv versuchte, zunächst das private<br />
Leben <strong>der</strong> Unterschichten zu organisieren,<br />
um revolutionäre Ereignisse wie 1848<br />
möglichst zu unterbinden, etwa mit dem<br />
Bau von Sozialwohnungen am Stadtrand von<br />
Paris. Sie waren so angelegt, dass die Polizei<br />
zügig eingreifen konnte. Auch wurden<br />
die Hausbesuche <strong>der</strong> Fürsorgerinnen<br />
zunächst mit <strong>der</strong> Begründung erf<strong>und</strong>en, den<br />
Schulbesuch aller Kin<strong>der</strong> sicherzustellen.<br />
Später wurden sie aber als geeignetes<br />
Instrument genutzt, um die private Lebensführung<br />
<strong>der</strong> Unterschichten sorgfältig zu<br />
kontrollieren. Auch zeigt Donzelot, wie die<br />
Mittelschichten über steigende Ansprüche<br />
an die »richtige« Sozialisation <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong><br />
zunehmend in die Abhängigkeit von Professionellen,<br />
in <strong>der</strong> Regel staatlich angestellt,<br />
gebracht wurden.