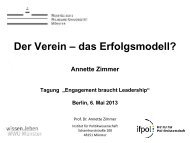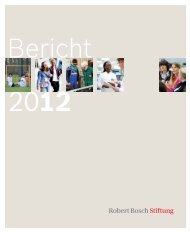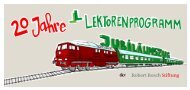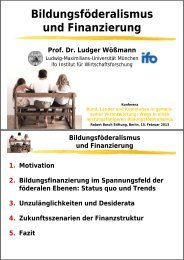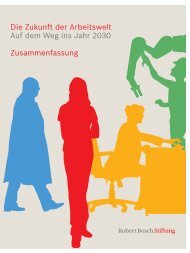Bericht der Kommission »Familie und demographischer Wandel
Bericht der Kommission »Familie und demographischer Wandel
Bericht der Kommission »Familie und demographischer Wandel
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
heute auf <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> revidierten OECD-<br />
Skala kommt mit etwa 15 Prozent (Eggen/<br />
Rupp 2006) auf fast ähnliche Werte wie in<br />
den 1950er Jahren, als es in Deutschland<br />
mit den damals großen ökonomischen<br />
Schwierigkeiten nicht leicht war, Arbeitsplätze<br />
für Mütter mit Kin<strong>der</strong>n zu bekommen,<br />
geschweige denn Betreuungsplätze für<br />
Kin<strong>der</strong> während <strong>der</strong> Arbeitszeit <strong>der</strong> Mütter.<br />
Auch wenn sich diese Zahlen wegen <strong>der</strong><br />
unterschiedlichen Rahmenbedingungen<br />
nicht vergleichen lassen, ist es für den deutschen<br />
Wohlfahrtsstaat skandalös, dass ausgerechnet<br />
die ökonomisch <strong>und</strong> politisch<br />
schwächste Gruppe am stärksten von relativer<br />
Armut betroffen ist. Das hängt einerseits<br />
damit zusammen, dass <strong>der</strong> deutsche<br />
Wohlfahrtsstaat an<strong>der</strong>s als Schweden o<strong>der</strong><br />
Finnland lange an <strong>der</strong> Fiktion festgehalten<br />
hat, eine Familie habe vom Einkommen des<br />
Haupternährers (Vater) zu leben; zudem sei<br />
die Trennung eines Paares ein »Betriebsunfall«,<br />
<strong>der</strong> sich dadurch ausgleichen lasse,<br />
dass <strong>der</strong> Haupternährer auch nach <strong>der</strong><br />
Trennung in <strong>der</strong> Lage sein müsse, <strong>der</strong> Familie,<br />
von <strong>der</strong> er sich getrennt hat, einen angemessenen<br />
Lebensstandard zu garantieren.<br />
Dabei zeigt <strong>der</strong> Vergleich (Abbildung 5),<br />
dass in allen europäischen Län<strong>der</strong>n, seien<br />
es die häufig positiv zitierten nordeuropäischen<br />
Sozialstaaten o<strong>der</strong> die südeuropäischen<br />
Län<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Deutschland, von den<br />
Familien, in denen die Mutter allein für sich<br />
<strong>und</strong> ihre Kin<strong>der</strong> ökonomisch sorgt, etwa ein<br />
Drittel unter <strong>der</strong> relativen Armutsgrenze<br />
des jeweiligen Landes liegt.<br />
Die in <strong>der</strong> deutschen Sozialpolitik lange<br />
vorherrschende Betonung <strong>der</strong> Rolle des<br />
Vaters als Haupternährer für alle familiären<br />
Lebensformen beruhte auf zwei Fehleinschätzungen.<br />
Die Entscheidung, als Paar<br />
gemeinsam ein Kind aufzuziehen, wird auch<br />
heute noch von den meisten Eltern in dieser<br />
Form getroffen. Und wie immer wie<strong>der</strong><br />
bestätigt wird, wächst auch sowohl in Ostwie<br />
in Westdeutschland die Mehrzahl aller<br />
Abbildung 5: Staatliche Transferleistungen<br />
im europäischen Vergleich<br />
Armutsraten vor <strong>und</strong> nach Transferleistungen 2001<br />
(in Prozent)<br />
Dänemark<br />
Finnland<br />
Österreich<br />
Deutschland<br />
Schweden<br />
Nie<strong>der</strong>lande<br />
Belgien<br />
Luxemburg<br />
Frankreich<br />
Alle<br />
Großbritannien<br />
Spanien<br />
Irland<br />
Portugal<br />
Italien<br />
Griechenland<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50<br />
nach Transferleistungen vor Transferleistungen<br />
Quelle: Heikkilä et al. 2006<br />
Kin<strong>der</strong> bei ihren beiden Eltern auf (zwischen<br />
65 <strong>und</strong> 85 Prozent). Allerdings<br />
bedeutet die Entscheidung für ein Kind<br />
heute nicht mehr in allen Fällen, immer<br />
gemeinsam mit dem Vater o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Mutter<br />
des Kindes zu leben. Treue, Partnerschaft<br />
<strong>und</strong> wechselseitige Verlässlichkeit sind auch<br />
heute in einer Beziehung ebenso hohe<br />
Werte wie vor 30 o<strong>der</strong> 40 Jahren (Schmidt/<br />
Dekker/Matthiesen/Starke 2006). Allerdings<br />
wird heute gesellschaftlich akzeptiert, dass<br />
Treue <strong>und</strong> Partnerschaft nicht notwendigerweise<br />
ein Leben lang, das selbst viel länger<br />
geworden ist, halten müssen. Neben dem<br />
Konzept einer lebenslangen Beziehung in