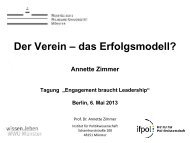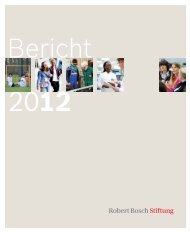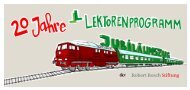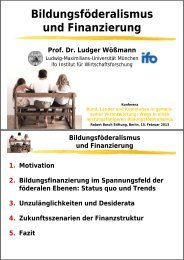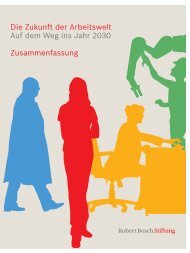Bericht der Kommission »Familie und demographischer Wandel
Bericht der Kommission »Familie und demographischer Wandel
Bericht der Kommission »Familie und demographischer Wandel
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Formulierung »Wachstum ist zwar nicht<br />
alles, aber ohne Wachstum ist alles nichts«<br />
stimmen noch immer 60 Prozent zu. Verlässt<br />
man die abstrakte, durch das Medienumfeld<br />
vermittelte Ebene, än<strong>der</strong>t sich das<br />
Bild. Zwar ist auch dann finanzieller Wohlstand<br />
noch immer bedeutsam. Aber Wirtschaftswachstum<br />
<strong>und</strong> Wohlstandssteigerung<br />
gehören nicht zu den Dingen, die das Wohlergehen<br />
<strong>der</strong> meisten vorrangig bestimmen.<br />
Nur 19 Prozent können sich dafür erwärmen,<br />
»hart zu arbeiten <strong>und</strong> beruflich viel zu<br />
leisten«. Bei <strong>der</strong> Beantwortung <strong>der</strong> Frage, ob<br />
sie in ihrem Leben etwas schaffen o<strong>der</strong> es<br />
eher ruhiger <strong>und</strong> gemütlicher haben wollen,<br />
bilden sich zwei etwa gleiche Gruppen. Die<br />
unter 45-Jährigen sind »ein wenig« schaffensgeneigt<br />
die über 45-Jährigen umso<br />
ruhegeneigter – »ein für eine zügig alternde<br />
Bevölkerung aufschlussreicher Bef<strong>und</strong>«,<br />
wie die Autoren hinzufügen.<br />
Ein ähnliches Bild bietet sich, wenn es um<br />
die Verbesserung des Einkommens geht.<br />
Nur 45 Prozent <strong>der</strong> Befragten sind bereit,<br />
<strong>und</strong> keineswegs vor allem die wirtschaftlich<br />
Schwächeren, für einen höheren Lohn mehr<br />
zu arbeiten. Von den nicht erwerbstätigen<br />
30- bis 60-Jährigen erklären r<strong>und</strong> 44 Prozent,<br />
sie hätten in den letzten drei Jahren<br />
nichts unternommen, um ihr Einkommen zu<br />
verbessern. Bei den unter 30-Jährigen sind<br />
es 35 Prozent. Die Antwort auf die Frage, in<br />
welchem Alter mit <strong>der</strong> Erwerbsarbeit<br />
Schluss sein soll, ergibt einen Mittelwert,<br />
<strong>der</strong> bei 61 Jahren liegt. Ein Rentenbeginn<br />
mit 65 o<strong>der</strong> erst mit 67 Jahren ist <strong>der</strong> großen<br />
Bevölkerungsmehrheit zu spät.<br />
59 Prozent erklären, dass ihnen die Bewahrung<br />
des Erreichten wichtiger sei als<br />
Wachstum <strong>und</strong> materielle Wohlstandsmehrung.<br />
Nur je<strong>der</strong> Vierte strebt nach mehr, vor<br />
allem die unter 30-Jährigen. Doch schon<br />
vom 30. Lebensjahr an bilden die Bewahrer<br />
die Mehrheit. »Bewahren ist vielen wichtiger<br />
als Mehren, Sicherheit <strong>und</strong> Gleichheit<br />
erstrebenswerter als Chancen <strong>und</strong> Risiken<br />
von Freiheit <strong>und</strong> Eigenverantwortung.«<br />
Soziale <strong>und</strong> innere Sicherheit »ist vielen ein<br />
so hohes Gut, dass sie bereit sind, dafür vieles<br />
hinzugeben, einschließlich zentraler<br />
Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Freiheitsrechte« (Miegel/Petersen<br />
2008). 78 Prozent ziehen ein »sicheres<br />
Leben in Bescheidenheit« einem »risikoreichen<br />
Leben <strong>und</strong> seinen finanziellen Chancen«<br />
vor.<br />
Insgesamt ziehen die Autoren aus den<br />
Ergebnissen <strong>der</strong> Studie den Schluss: Die<br />
mentalen Voraussetzungen für Wirtschaftswachstum<br />
<strong>und</strong> materielle Wohlstandsmehrung<br />
sind nur noch bedingt vorhanden. Nur<br />
ein Sechstel bis höchstens ein Fünftel <strong>der</strong><br />
Bevölkerung ist bereit, sich konsequent für<br />
Wachstum zu engagieren. Als Gründe<br />
erkennen die Autoren eine weitgehende Sättigung<br />
materieller Bedürfnisse, den abnehmenden<br />
Grenznutzen zusätzlicher Anstrengungen,<br />
den Verlust <strong>der</strong> sinnstiftenden Wirkung<br />
einer weiteren materiellen Wohlstandsmehrung<br />
o<strong>der</strong> die ernüchternde<br />
Erkenntnis <strong>der</strong> schädlichen Folgen ständigen<br />
Wirtschaftswachstums. Insgesamt folgt<br />
aus dem <strong>Wandel</strong> <strong>der</strong> Einstellung großer<br />
Teile <strong>der</strong> Bevölkerung, »dass die bisherigen<br />
Wachstumsstrategien zunehmend auf Sand<br />
gebaut sind« (Miegel/Petersen 2008). Es sei<br />
deshalb geboten, die bisherigen politischen<br />
<strong>und</strong> wirtschaftlichen Handlungsmuster von<br />
Gr<strong>und</strong> auf zu überdenken. Denn »es ist irrational<br />
<strong>und</strong> gefährlich, eine befriedigende<br />
Beschäftigungslage, soziale Sicherheit o<strong>der</strong><br />
gar die Stabilität <strong>der</strong> freiheitlich-demokratischen<br />
Ordnung von Wirtschaftswachstum<br />
<strong>und</strong> materieller Wohlstandsmehrung abhängig<br />
zu machen« (Miegel/Petersen 2008).<br />
Fehlt jedoch ein ausreichen<strong>der</strong>, durch persönliche<br />
wie gesellschaftliche Interessen<br />
<strong>und</strong> Ziele angetriebener Wille zu mehr<br />
Wachstum, dann ist es sozialpolitisch problematisch,<br />
die in <strong>der</strong> Zeit des Wie<strong>der</strong>aufbaus<br />
<strong>der</strong> B<strong>und</strong>esrepublik vorhandenen<br />
Motivationsstrukturen kritiklos auf eine Zeit<br />
zu übertragen, in <strong>der</strong> bereits das Gesetz des