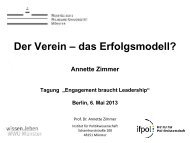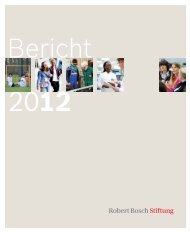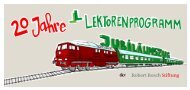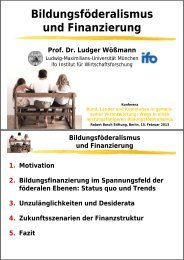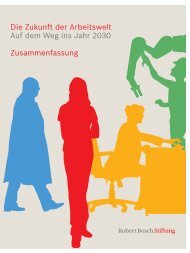Bericht der Kommission »Familie und demographischer Wandel
Bericht der Kommission »Familie und demographischer Wandel
Bericht der Kommission »Familie und demographischer Wandel
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
94 95<br />
Gastbeiträge<br />
Die <strong>Kommission</strong> hat zu ihren Sitzungen eine<br />
Reihe von Experten eingeladen, <strong>der</strong>en wissenschaftliche<br />
Positionen <strong>und</strong> politische<br />
Meinungen ihr für ihre Diskussion för<strong>der</strong>lich<br />
erschienen. Die unterschiedlichen Vorträge<br />
erstreckten sich auf Gr<strong>und</strong>sätzliches<br />
zum Subsidiaritätsbegriff, die sozialstaatlichen<br />
Rahmenbedingungen, kommunale<br />
Familienpolitik <strong>und</strong> die Chancen von Subsidiarität<br />
in großstädtischen Problemquartieren.<br />
Die Beiträge von Tine Stein, Bert Rürup<br />
<strong>und</strong> Anja Ranscht, Barbara Riedmüller,<br />
Claus Offe, Hartmut Häussermann, Klaus<br />
Peter Strohmeier sowie Volker Hassemer<br />
sind im Folgenden wie<strong>der</strong>gegeben. Der Beitrag<br />
von Heinz Buschkowsky ist in <strong>der</strong> Form<br />
eines Interviews verfasst. Die von <strong>der</strong> Stiftung<br />
bei <strong>der</strong> Prognos AG in Auftrag gegebene<br />
Recherche ist ebenfalls in weiten<br />
Teilen wie<strong>der</strong>gegeben. Den Beiträgen ist<br />
jeweils eine kurze Zusammenfassung vorangestellt.<br />
Tine Stein arbeitet in ihrem Beitrag die<br />
geschichtlichen Hintergründe des Subsidiaritätsprinzips<br />
heraus, wie sie vor allem in<br />
<strong>der</strong> katholischen Soziallehre fassbar sind,<br />
<strong>und</strong> dokumentiert ihre wachsende Relevanz<br />
unter den Bedingungen von Globalisierung<br />
<strong>und</strong> Umbau des Sozialstaates. In ihrem Beitrag<br />
<strong>»Familie</strong>npolitik <strong>und</strong> soziale Sicherung«<br />
analysieren Bert Rürup <strong>und</strong> Anja Ranscht<br />
die Wechselwirkung von <strong>demographischer</strong><br />
Entwicklung, Familienpolitik <strong>und</strong> sozialen<br />
Sicherungssystemen. Dabei wird <strong>der</strong> Einfluss<br />
<strong>der</strong> Familienpolitik auf Renten- <strong>und</strong><br />
Krankenversicherung deutlich, <strong>und</strong> es wird<br />
gezeigt, welche unterschiedlichen familienpolitischen<br />
Elemente in diesen Systemen<br />
Berücksichtigung finden. Das familienpolitische<br />
Leitbild <strong>der</strong> vergangenen Jahrzehnte<br />
untersucht Barbara Riedmüller anhand <strong>der</strong><br />
Frage »Ein neues Geschlechterverhältnis?<br />
Familienpolitik muss sich verän<strong>der</strong>ten Realitäten<br />
anpassen« – <strong>und</strong> gibt dazu gleich die<br />
Antwort in Form einer For<strong>der</strong>ung. Die Familie<br />
sei lange als staatsferne Sphäre definiert<br />
<strong>und</strong> dabei doch durch die Politik in ihrer<br />
Rollenverteilung bestimmt worden, mit dem<br />
Ergebnis <strong>der</strong> Festschreibung des typisch<br />
deutschen Hausfrauenmodells.<br />
Ein Gegenmodell zum geläufigen Entlohnungs-<br />
<strong>und</strong> Transferleistungssystem entwirft<br />
Claus Offe unter dem Titel <strong>»Familie</strong>nleistung<br />
jenseits <strong>der</strong> Marktarbeit – das<br />
bedingungslose Gr<strong>und</strong>einkommen«. Für die<br />
Diskussion über Familie <strong>und</strong> kleine Lebenskreise<br />
ist diese Idee beson<strong>der</strong>s interessant:<br />
Je weniger <strong>der</strong> Staat seine Bürger durch<br />
materielle Anreize zu bestimmten Verhaltensweisen<br />
veranlasst, desto größer ist <strong>der</strong><br />
Freiraum für freiwilliges Handeln, wenn<br />
denn die materielle Gr<strong>und</strong>voraussetzung<br />
gegeben ist. Hartmut Häussermann zeichnet<br />
in seinem Beitrag »Die soziale Dimension<br />
unserer Städte – von <strong>der</strong> ›Integrationsmaschine‹<br />
zu neuen Ungleichheiten« die problematische<br />
Entwicklung nach, die sich in<br />
allen europäischen (Groß-)Städten in ähnlicher<br />
Form vollzieht: Auf eine Homogenisierung<br />
<strong>der</strong> Lebensstile im 20. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
folgt eine Phase starker Ausdifferenzierung<br />
<strong>und</strong> Polarisierung mit <strong>der</strong> Folge, dass Städte<br />
<strong>und</strong> Wohnviertel durch gleichzeitige Bewohnung<br />
von einkommensschwachen Familien<br />
<strong>und</strong> einkommensstarken Bevölkerungsgruppen<br />
– Singles, Doppelverdiener, aber auch<br />
Familien – auseinan<strong>der</strong>driften.<br />
Klaus Peter Strohmeier macht unter dem<br />
Titel »Die Stadt im <strong>Wandel</strong> – Wie<strong>der</strong>gewinnung<br />
von Solidarpotential« am Beispiel des<br />
Ruhrgebiets deutlich, wie sich durch Entsolidarisierung<br />
– durch gegenseitiges Misstrauen<br />
– Abgrenzung <strong>und</strong> Vereinzelung ausbreiten.<br />
Die typische »Kultur des Helfens<br />
<strong>und</strong> Borgens« sei mit <strong>der</strong> Abwertung <strong>der</strong><br />
klassischen Industriearbeit <strong>und</strong> <strong>der</strong> wachsenden<br />
Arbeitslosigkeit massiv im Rückzug.<br />
Dringend nötig seien Programme, die Vertrauen<br />
stiften <strong>und</strong> die Erfahrung beför<strong>der</strong>n,<br />
dass Engagement sich lohnt.<br />
Für Volker Hassemer in seinem Beitrag »Für<br />
eine familienorientierte Stadtpolitik« ist es