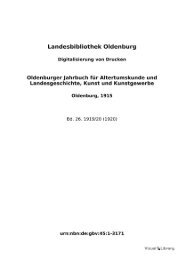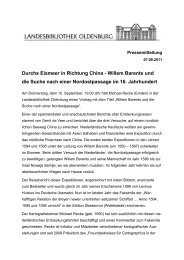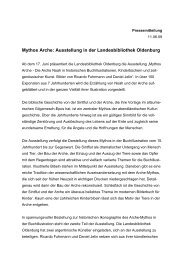Oldenburger Jahrbuch - der Landesbibliothek Oldenburg
Oldenburger Jahrbuch - der Landesbibliothek Oldenburg
Oldenburger Jahrbuch - der Landesbibliothek Oldenburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
übereinan<strong>der</strong> angetroffen. Da keine Beobachtungen über die Grabgruben<br />
vorliegen, kann es sich dabei ebensogut um Nachbestattungen handeln. Das<br />
gleiche gilt für die in den genannten Hügeln bzw. in <strong>der</strong> Düne auftretende<br />
Erscheinung, daß gelegentlich zwei Urnen Wand an Wand standen. Alle<br />
Belege stammen aus <strong>der</strong> Eisenzeit.<br />
Die Urnen o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Leichenbrand wurden häufig durch eine Bedeckung<br />
geschützt. Dafür fanden außer den oben erwähnten Steinen und Heideplaggen<br />
auch größere Gefäßscherben und Gefäßunterteile sowie eigene<br />
Deckeltypen Verwendung: im Norden <strong>Oldenburg</strong>s hauptsächlich die Deck-<br />
schalcn mit abgesetztem Schrägrand23), im Süden überwiegend Deckschalen<br />
mit gerade auslaufendem Rand, selten einige an<strong>der</strong>e Formen. Sichere<br />
Belege für das jungbronzezeitliche Alter von Urnendeckeln können nicht<br />
genannt werden. Zu den frühesten Exemplaren, die man am ehesten noch<br />
in die Jungbronzezeit, in die ausgehende P. V., o<strong>der</strong> in eine Ubergangsphase<br />
P. V/VI stellen möchte, gehören neben einigen Deckschalen mit abgesetztem<br />
Schrägrand eine Zipfelschale mit gekerbtem Rand, Tonscheiben und einige<br />
Kappen- und Stöpseldeckel. Da diese Formen aus <strong>der</strong> Lausitzer Kultur und<br />
ihren Nachfolgegruppen entlehnt sind, ist zu vermuten, daß von dort auch<br />
die Sitte, Urnen m it Deckeln zu verschließen, nach <strong>Oldenburg</strong> verm ittelt<br />
wurde. Auf dem jungbronzezeitlichen Gräberfeld von Busch/Dötlingen,<br />
dessen Urnen und Beigefäße neben einheimischen Elementen nur solche <strong>der</strong><br />
süddeutschen U rnenfel<strong>der</strong>kultur zeigen, wurden keine Urnendeckel angetroffen.<br />
Das steht im Gegensatz zum Brauch in Süddeutschland. Allerdings<br />
ist schon in Westfalen „nur ein geringer Prozentsatz <strong>der</strong> Urnen mit einer<br />
Schale verschlossen“ 43), so daß man im Urnenfel<strong>der</strong>bereich möglicherweise<br />
eine Abnahme <strong>der</strong> Sitte von Süd nach N ord annehmen kann.<br />
Auf den eisenzeitlichen Bestattungsplätzen im Südteil des Arbeitsgebietes ist<br />
die Häufigkeit <strong>der</strong> Deckschalen sehr verschieden. Einer Gruppe von Friedhöfen,<br />
in denen man die Ausstattung mit einer Deckschale als Sitte bezeichnen<br />
kann — Mahnenberg, Ruppenberg, Grapperhausen, Calhorn — stehen<br />
an<strong>der</strong>e gegenüber, von denen trotz zahlreicher Urnenfunde nur bis zu drei<br />
Schalen ins Museum gelangten — Molbergen, Ermke, Ambühren, Altenbunnen,<br />
Joel (Hügel 21 und 23). An<strong>der</strong>e Plätze — Stedingsmühlen, Lahr,<br />
Darrel, Joel-Düne und Resthausen — stehen nach <strong>der</strong> Menge <strong>der</strong> vorhandenen<br />
Deckschalen zwischen den beiden Gruppen. Ob für diese Verteilung<br />
nur die zufällige Auswahl <strong>der</strong> ins Museum gekommenen Funde verantw ortlich<br />
ist o<strong>der</strong> ob sie einer unterschiedlichen Ausstattungssitte entspricht, kann<br />
nicht gesagt werden.<br />
4S) H . Aschemeyer, 1966, 25.<br />
91