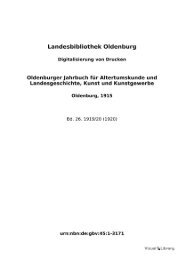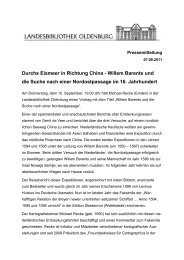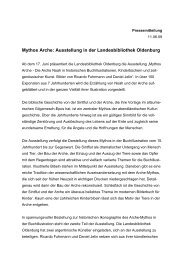Oldenburger Jahrbuch - der Landesbibliothek Oldenburg
Oldenburger Jahrbuch - der Landesbibliothek Oldenburg
Oldenburger Jahrbuch - der Landesbibliothek Oldenburg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Bei dem Großhaus N r. 50 (Quadrat B 3/III—VI) ist eine strenge Zweiteilung des<br />
ganzen Hauses zu beobachten. Der hintere Teil ist ganz von einem Wandgraben<br />
umgeben, in dem in genau 0,60 m Abstand die Außenwandpfosten stehen. Daran<br />
folgt nach Westen zu ein Anbau, <strong>der</strong> zwar auch noch enggesetzte Wandpfosten, aber<br />
keinen Wandgraben mehr aufweist. Auch unterscheidet sich nach dem Befund die<br />
G erüstkonstruktion des „Wohnteiles“ im Osten völlig von <strong>der</strong> des „Wirtschaftsteiles“<br />
im Westen. Um eine Rekonstruktion dieses Hauses zu versuchen, müssen aber<br />
erst die Detailpläne aufgearbeitet werden.<br />
Die Vorgefundenen Speicher gehören alle dem Sechspfostentyp an. Auffällig sind<br />
bei ihnen die starken Pfosten, <strong>der</strong>en Durchmesser häufig erheblich über dem <strong>der</strong><br />
Großhäuser liegt.<br />
Auf <strong>der</strong> freigelegten Fläche wurden insgesamt vier Brunnen gefunden.<br />
N r. 140 Brunnenschacht aus 2,10 m langen Birkenstämmen bestehend, darin ein<br />
einfacher Holzkastcn (ein Brett hoch) aus übereinan<strong>der</strong> gekämmten<br />
Eichenbrettern. Auf <strong>der</strong> Brunnensohle neben Scherben viele Eichenblätter.<br />
N r. 198 Baumstammbrunnen (durch Feuer ausgehöhlte Eiche) Stammlänge: 1,15 m<br />
N r. 237 Brunnenschacht auch aus Birkenpfählen, ähnlich N r. 140. Im Brunnen<br />
eine 1,50 m lange, dreisprossige Leiter.<br />
N r. 218 Quadratischer Brunnenkasten aus geklövten Dreikantbohlen und Q uerplanken.<br />
Im Kasten ein ausgehöhlter Baumstamm.<br />
Alle hier genannten Brunnen sind <strong>der</strong> römischen Kaiserzeit zuzuschreiben.<br />
Eine beson<strong>der</strong>e Rolle im Bereich <strong>der</strong> frührömischen Kaiserzeit spielen die Eisenschmelzöfen.<br />
Sie liegen immer zu mehreren in <strong>der</strong> Nähe <strong>der</strong> Gehöfte, aber<br />
immer wohl in brandsicherer Entfernung. Von den Öfen können nur nodi die<br />
kleinen Schlackengruben gefunden werden, <strong>der</strong>en Durchmesser zwischen 0,40—0,60<br />
Meter liegt. Die Tiefe beträgt 0,25—0,40 Meter.<br />
Das verhüttete Raseneisenerz steht unm ittelbar hinter <strong>der</strong> Siedlung in <strong>der</strong> Nie<strong>der</strong>ung<br />
<strong>der</strong> Halfste<strong>der</strong> Bäke an.<br />
Im Bereich <strong>der</strong> spätrömischen- und völkerwan<strong>der</strong>ungszeitlichen Siedlung wurden<br />
zwar auch noch vereinzelt Eisenschlacken gefunden, jedoch wurden hier bisher<br />
noch keine Schmelzöfen freigelegt. Nach den bisherigen Ergebnissen scheint die<br />
Eisengewinnung aus Raseneisenerz in den Jahrhun<strong>der</strong>ten um Chr. Geb. ihren<br />
H öhepunkt erreicht zu haben.<br />
D. Zoller<br />
134