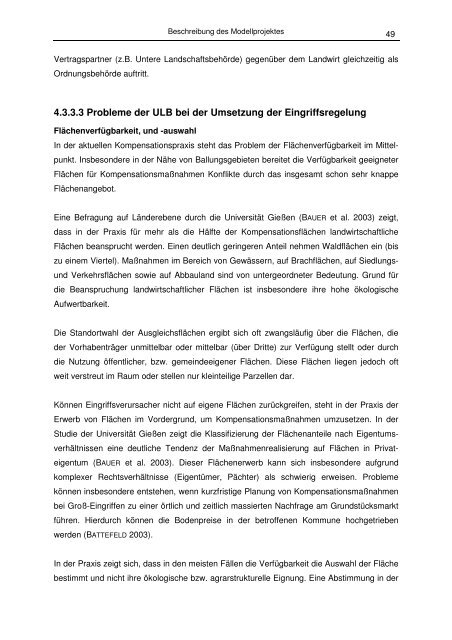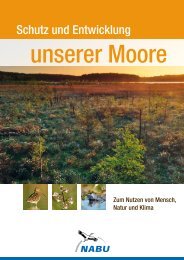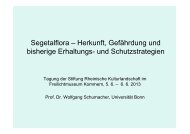Abschlussbericht Bördeprojekt - Stiftung Rheinische Kulturlandschaft
Abschlussbericht Bördeprojekt - Stiftung Rheinische Kulturlandschaft
Abschlussbericht Bördeprojekt - Stiftung Rheinische Kulturlandschaft
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Beschreibung des Modellprojektes 49<br />
Vertragspartner (z.B. Untere Landschaftsbehörde) gegenüber dem Landwirt gleichzeitig als<br />
Ordnungsbehörde auftritt.<br />
4.3.3.3 Probleme der ULB bei der Umsetzung der Eingriffsregelung<br />
Flächenverfügbarkeit, und -auswahl<br />
In der aktuellen Kompensationspraxis steht das Problem der Flächenverfügbarkeit im Mittelpunkt.<br />
Insbesondere in der Nähe von Ballungsgebieten bereitet die Verfügbarkeit geeigneter<br />
Flächen für Kompensationsmaßnahmen Konflikte durch das insgesamt schon sehr knappe<br />
Flächenangebot.<br />
Eine Befragung auf Länderebene durch die Universität Gießen (BAUER et al. 2003) zeigt,<br />
dass in der Praxis für mehr als die Hälfte der Kompensationsflächen landwirtschaftliche<br />
Flächen beansprucht werden. Einen deutlich geringeren Anteil nehmen Waldflächen ein (bis<br />
zu einem Viertel). Maßnahmen im Bereich von Gewässern, auf Brachflächen, auf Siedlungsund<br />
Verkehrsflächen sowie auf Abbauland sind von untergeordneter Bedeutung. Grund für<br />
die Beanspruchung landwirtschaftlicher Flächen ist insbesondere ihre hohe ökologische<br />
Aufwertbarkeit.<br />
Die Standortwahl der Ausgleichsflächen ergibt sich oft zwangsläufig über die Flächen, die<br />
der Vorhabenträger unmittelbar oder mittelbar (über Dritte) zur Verfügung stellt oder durch<br />
die Nutzung öffentlicher, bzw. gemeindeeigener Flächen. Diese Flächen liegen jedoch oft<br />
weit verstreut im Raum oder stellen nur kleinteilige Parzellen dar.<br />
Können Eingriffsverursacher nicht auf eigene Flächen zurückgreifen, steht in der Praxis der<br />
Erwerb von Flächen im Vordergrund, um Kompensationsmaßnahmen umzusetzen. In der<br />
Studie der Universität Gießen zeigt die Klassifizierung der Flächenanteile nach Eigentumsverhältnissen<br />
eine deutliche Tendenz der Maßnahmenrealisierung auf Flächen in Privateigentum<br />
(BAUER et al. 2003). Dieser Flächenerwerb kann sich insbesondere aufgrund<br />
komplexer Rechtsverhältnisse (Eigentümer, Pächter) als schwierig erweisen. Probleme<br />
können insbesondere entstehen, wenn kurzfristige Planung von Kompensationsmaßnahmen<br />
bei Groß-Eingriffen zu einer örtlich und zeitlich massierten Nachfrage am Grundstücksmarkt<br />
führen. Hierdurch können die Bodenpreise in der betroffenen Kommune hochgetrieben<br />
werden (BATTEFELD 2003).<br />
In der Praxis zeigt sich, dass in den meisten Fällen die Verfügbarkeit die Auswahl der Fläche<br />
bestimmt und nicht ihre ökologische bzw. agrarstrukturelle Eignung. Eine Abstimmung in der