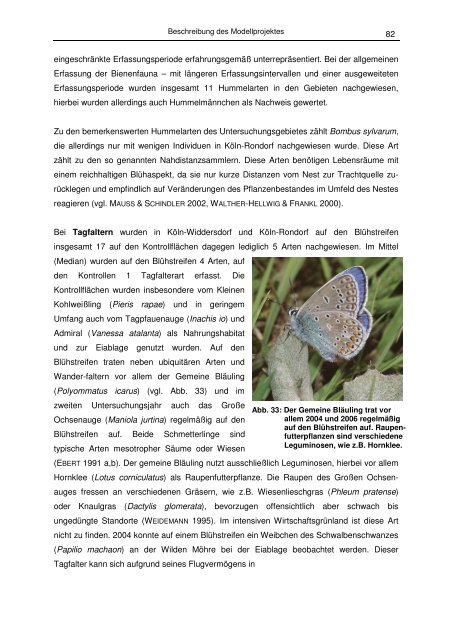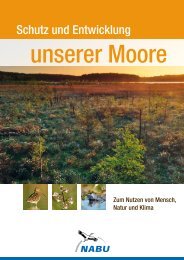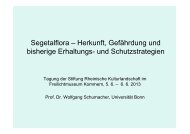Abschlussbericht Bördeprojekt - Stiftung Rheinische Kulturlandschaft
Abschlussbericht Bördeprojekt - Stiftung Rheinische Kulturlandschaft
Abschlussbericht Bördeprojekt - Stiftung Rheinische Kulturlandschaft
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Beschreibung des Modellprojektes 82<br />
eingeschränkte Erfassungsperiode erfahrungsgemäß unterrepräsentiert. Bei der allgemeinen<br />
Erfassung der Bienenfauna – mit längeren Erfassungsintervallen und einer ausgeweiteten<br />
Erfassungsperiode wurden insgesamt 11 Hummelarten in den Gebieten nachgewiesen,<br />
hierbei wurden allerdings auch Hummelmännchen als Nachweis gewertet.<br />
Zu den bemerkenswerten Hummelarten des Untersuchungsgebietes zählt Bombus sylvarum,<br />
die allerdings nur mit wenigen Individuen in Köln-Rondorf nachgewiesen wurde. Diese Art<br />
zählt zu den so genannten Nahdistanzsammlern. Diese Arten benötigen Lebensräume mit<br />
einem reichhaltigen Blühaspekt, da sie nur kurze Distanzen vom Nest zur Trachtquelle zurücklegen<br />
und empfindlich auf Veränderungen des Pflanzenbestandes im Umfeld des Nestes<br />
reagieren (vgl. MAUSS & SCHINDLER 2002, WALTHER-HELLWIG & FRANKL 2000).<br />
Bei Tagfaltern wurden in Köln-Widdersdorf und Köln-Rondorf auf den Blühstreifen<br />
insgesamt 17 auf den Kontrollflächen dagegen lediglich 5 Arten nachgewiesen. Im Mittel<br />
(Median) wurden auf den Blühstreifen 4 Arten, auf<br />
den Kontrollen 1 Tagfalterart erfasst. Die<br />
Kontrollflächen wurden insbesondere vom Kleinen<br />
Kohlweißling (Pieris rapae) und in geringem<br />
Umfang auch vom Tagpfauenauge (Inachis io) und<br />
Admiral (Vanessa atalanta) als Nahrungshabitat<br />
und zur Eiablage genutzt wurden. Auf den<br />
Blühstreifen traten neben ubiquitären Arten und<br />
Wander-faltern vor allem der Gemeine Bläuling<br />
(Polyommatus icarus) (vgl. Abb. 33) und im<br />
zweiten Untersuchungsjahr auch das Große<br />
Ochsenauge (Maniola jurtina) regelmäßig auf den<br />
Blühstreifen auf. Beide Schmetterlinge sind<br />
typische Arten mesotropher Säume oder Wiesen<br />
(EBERT 1991 a,b). Der gemeine Bläuling nutzt ausschließlich Leguminosen, hierbei vor allem<br />
Hornklee (Lotus corniculatus) als Raupenfutterpflanze. Die Raupen des Großen Ochsenauges<br />
fressen an verschiedenen Gräsern, wie z.B. Wiesenlieschgras (Phleum pratense)<br />
oder Knaulgras (Dactylis glomerata), bevorzugen offensichtlich aber schwach bis<br />
ungedüngte Standorte (WEIDEMANN 1995). Im intensiven Wirtschaftsgrünland ist diese Art<br />
nicht zu finden. 2004 konnte auf einem Blühstreifen ein Weibchen des Schwalbenschwanzes<br />
(Papilio machaon) an der Wilden Möhre bei der Eiablage beobachtet werden. Dieser<br />
Tagfalter kann sich aufgrund seines Flugvermögens in<br />
Abb. 33: Der Gemeine Bläuling trat vor<br />
allem 2004 und 2006 regelmäßig<br />
auf den Blühstreifen auf. Raupenfutterpflanzen<br />
sind verschiedene<br />
Leguminosen, wie z.B. Hornklee.