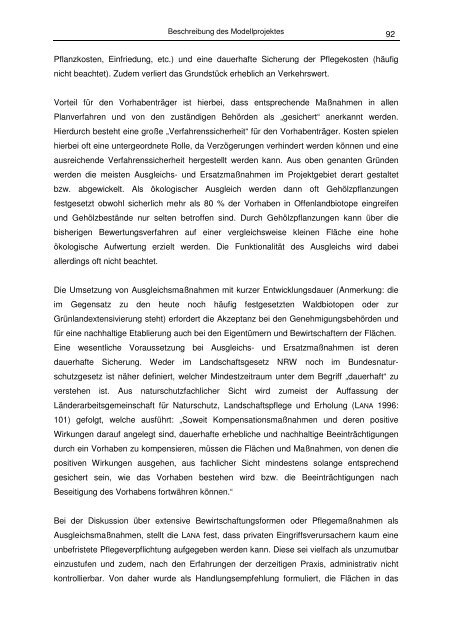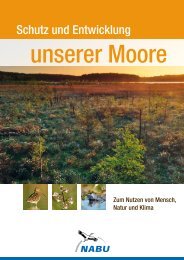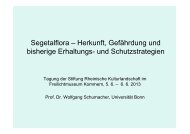Abschlussbericht Bördeprojekt - Stiftung Rheinische Kulturlandschaft
Abschlussbericht Bördeprojekt - Stiftung Rheinische Kulturlandschaft
Abschlussbericht Bördeprojekt - Stiftung Rheinische Kulturlandschaft
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Beschreibung des Modellprojektes 92<br />
Pflanzkosten, Einfriedung, etc.) und eine dauerhafte Sicherung der Pflegekosten (häufig<br />
nicht beachtet). Zudem verliert das Grundstück erheblich an Verkehrswert.<br />
Vorteil für den Vorhabenträger ist hierbei, dass entsprechende Maßnahmen in allen<br />
Planverfahren und von den zuständigen Behörden als „gesichert“ anerkannt werden.<br />
Hierdurch besteht eine große „Verfahrenssicherheit“ für den Vorhabenträger. Kosten spielen<br />
hierbei oft eine untergeordnete Rolle, da Verzögerungen verhindert werden können und eine<br />
ausreichende Verfahrenssicherheit hergestellt werden kann. Aus oben genanten Gründen<br />
werden die meisten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Projektgebiet derart gestaltet<br />
bzw. abgewickelt. Als ökologischer Ausgleich werden dann oft Gehölzpflanzungen<br />
festgesetzt obwohl sicherlich mehr als 80 % der Vorhaben in Offenlandbiotope eingreifen<br />
und Gehölzbestände nur selten betroffen sind. Durch Gehölzpflanzungen kann über die<br />
bisherigen Bewertungsverfahren auf einer vergleichsweise kleinen Fläche eine hohe<br />
ökologische Aufwertung erzielt werden. Die Funktionalität des Ausgleichs wird dabei<br />
allerdings oft nicht beachtet.<br />
Die Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen mit kurzer Entwicklungsdauer (Anmerkung: die<br />
im Gegensatz zu den heute noch häufig festgesetzten Waldbiotopen oder zur<br />
Grünlandextensivierung steht) erfordert die Akzeptanz bei den Genehmigungsbehörden und<br />
für eine nachhaltige Etablierung auch bei den Eigentümern und Bewirtschaftern der Flächen.<br />
Eine wesentliche Voraussetzung bei Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist deren<br />
dauerhafte Sicherung. Weder im Landschaftsgesetz NRW noch im Bundesnaturschutzgesetz<br />
ist näher definiert, welcher Mindestzeitraum unter dem Begriff „dauerhaft“ zu<br />
verstehen ist. Aus naturschutzfachlicher Sicht wird zumeist der Auffassung der<br />
Länderarbeitsgemeinschaft für Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung (LANA 1996:<br />
101) gefolgt, welche ausführt: „Soweit Kompensationsmaßnahmen und deren positive<br />
Wirkungen darauf angelegt sind, dauerhafte erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen<br />
durch ein Vorhaben zu kompensieren, müssen die Flächen und Maßnahmen, von denen die<br />
positiven Wirkungen ausgehen, aus fachlicher Sicht mindestens solange entsprechend<br />
gesichert sein, wie das Vorhaben bestehen wird bzw. die Beeinträchtigungen nach<br />
Beseitigung des Vorhabens fortwähren können.“<br />
Bei der Diskussion über extensive Bewirtschaftungsformen oder Pflegemaßnahmen als<br />
Ausgleichsmaßnahmen, stellt die LANA fest, dass privaten Eingriffsverursachern kaum eine<br />
unbefristete Pflegeverpflichtung aufgegeben werden kann. Diese sei vielfach als unzumutbar<br />
einzustufen und zudem, nach den Erfahrungen der derzeitigen Praxis, administrativ nicht<br />
kontrollierbar. Von daher wurde als Handlungsempfehlung formuliert, die Flächen in das