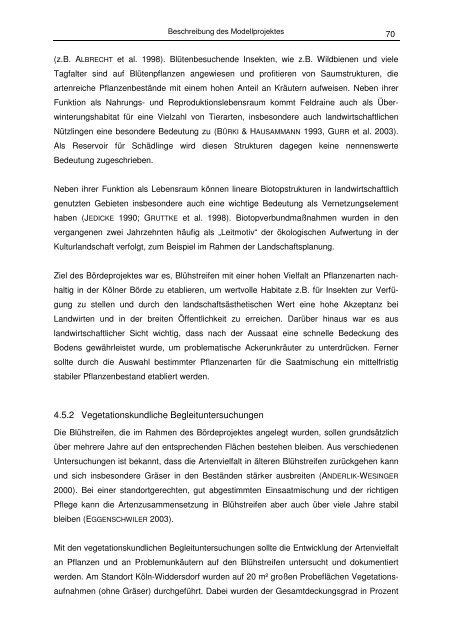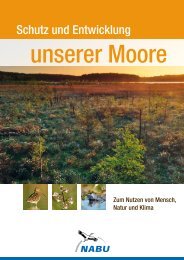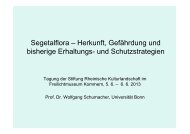Abschlussbericht Bördeprojekt - Stiftung Rheinische Kulturlandschaft
Abschlussbericht Bördeprojekt - Stiftung Rheinische Kulturlandschaft
Abschlussbericht Bördeprojekt - Stiftung Rheinische Kulturlandschaft
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Beschreibung des Modellprojektes 70<br />
(z.B. ALBRECHT et al. 1998). Blütenbesuchende Insekten, wie z.B. Wildbienen und viele<br />
Tagfalter sind auf Blütenpflanzen angewiesen und profitieren von Saumstrukturen, die<br />
artenreiche Pflanzenbestände mit einem hohen Anteil an Kräutern aufweisen. Neben ihrer<br />
Funktion als Nahrungs- und Reproduktionslebensraum kommt Feldraine auch als Überwinterungshabitat<br />
für eine Vielzahl von Tierarten, insbesondere auch landwirtschaftlichen<br />
Nützlingen eine besondere Bedeutung zu (BÜRKI & HAUSAMMANN 1993, GURR et al. 2003).<br />
Als Reservoir für Schädlinge wird diesen Strukturen dagegen keine nennenswerte<br />
Bedeutung zugeschrieben.<br />
Neben ihrer Funktion als Lebensraum können lineare Biotopstrukturen in landwirtschaftlich<br />
genutzten Gebieten insbesondere auch eine wichtige Bedeutung als Vernetzungselement<br />
haben (JEDICKE 1990; GRUTTKE et al. 1998). Biotopverbundmaßnahmen wurden in den<br />
vergangenen zwei Jahrzehnten häufig als „Leitmotiv“ der ökologischen Aufwertung in der<br />
<strong>Kulturlandschaft</strong> verfolgt, zum Beispiel im Rahmen der Landschaftsplanung.<br />
Ziel des <strong>Bördeprojekt</strong>es war es, Blühstreifen mit einer hohen Vielfalt an Pflanzenarten nachhaltig<br />
in der Kölner Börde zu etablieren, um wertvolle Habitate z.B. für Insekten zur Verfügung<br />
zu stellen und durch den landschaftsästhetischen Wert eine hohe Akzeptanz bei<br />
Landwirten und in der breiten Öffentlichkeit zu erreichen. Darüber hinaus war es aus<br />
landwirtschaftlicher Sicht wichtig, dass nach der Aussaat eine schnelle Bedeckung des<br />
Bodens gewährleistet wurde, um problematische Ackerunkräuter zu unterdrücken. Ferner<br />
sollte durch die Auswahl bestimmter Pflanzenarten für die Saatmischung ein mittelfristig<br />
stabiler Pflanzenbestand etabliert werden.<br />
4.5.2 Vegetationskundliche Begleituntersuchungen<br />
Die Blühstreifen, die im Rahmen des <strong>Bördeprojekt</strong>es angelegt wurden, sollen grundsätzlich<br />
über mehrere Jahre auf den entsprechenden Flächen bestehen bleiben. Aus verschiedenen<br />
Untersuchungen ist bekannt, dass die Artenvielfalt in älteren Blühstreifen zurückgehen kann<br />
und sich insbesondere Gräser in den Beständen stärker ausbreiten (ANDERLIK-WESINGER<br />
2000). Bei einer standortgerechten, gut abgestimmten Einsaatmischung und der richtigen<br />
Pflege kann die Artenzusammensetzung in Blühstreifen aber auch über viele Jahre stabil<br />
bleiben (EGGENSCHWILER 2003).<br />
Mit den vegetationskundlichen Begleituntersuchungen sollte die Entwicklung der Artenvielfalt<br />
an Pflanzen und an Problemunkäutern auf den Blühstreifen untersucht und dokumentiert<br />
werden. Am Standort Köln-Widdersdorf wurden auf 20 m² großen Probeflächen Vegetationsaufnahmen<br />
(ohne Gräser) durchgeführt. Dabei wurden der Gesamtdeckungsgrad in Prozent