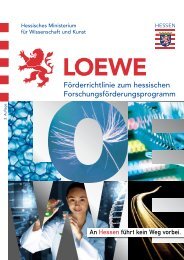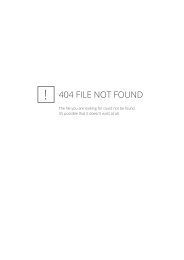LOEWE Jahresbericht 2012 - Hessisches Ministerium für ...
LOEWE Jahresbericht 2012 - Hessisches Ministerium für ...
LOEWE Jahresbericht 2012 - Hessisches Ministerium für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
9 Bewilligte Projekte 5. Förderstaffel (zentrum und Schwerpunkte)<br />
<strong>LOEWE</strong>-Schwerpunkt IPF<br />
Integrative Pilzforschung<br />
Partner Goethe-Universität Frankfurt am Main (GU) (Federführung), Justus-Liebig-Universität<br />
Gießen (JLU), Universität Kassel, Philipps-Universität Marburg, Senckenberg Gesellschaft<br />
<strong>für</strong> Naturforschung Frankfurt am Main<br />
Koordinatoren Prof Dr. Marco Thines, Prof. Dr. Helge Bode, Goethe-Universität Frankfurt am Main<br />
Homepage www.integrative-pilzforschung.de<br />
> Aufbauphase<br />
Förderzeitraum 1. Januar 2013 – 31. Dezember 2015<br />
Landesförderung 4.473.000 Euro<br />
2013 1.497.000 Euro<br />
2014 1.484.400 Euro<br />
2015 1.491.600 Euro<br />
150<br />
Leitziele<br />
Grundidee des IPF ist die Innovation durch Integration anwendungs- und grundlagenorientierter Forschung<br />
bei der Erschließung der pilzlichen Vielfalt. Pilze sind artenreicher als Pflanzen, Säugetiere und Fische<br />
zusammen, wobei nach konservativen Schätzungen noch mehr als 90 % ihrer Arten unentdeckt sind. Dennoch<br />
werden mit wenigen Dutzend Arten bereits mehrere Milliarden Euro jährlich erwirtschaftet – in der<br />
Medizin als Produzenten von Antibiotika und Immunsuppressiva, in der Biotechnologie als Produzenten<br />
von Bioethanol und Plattformchemikalien und in der Lebensmitteltechnologie bei der Produktion von Brot,<br />
Käse, Bier, Wein und Wurst. Durch die Integration von anwendungsorientierter biochemischer, molekularbiologischer<br />
und biotechnologischer Forschung und grundlagenorientierter Biodiversitätsforschung werden<br />
neue Wege beschritten, um die Ressource der pilzlichen Diversität <strong>für</strong> die wirtschaftliche Nutzung zu<br />
erschließen.<br />
Nach Ende des Bewilligungszeitraumes soll der <strong>LOEWE</strong>-Schwerpunkt im Rahmen eines SFB und eines<br />
Graduiertenkollegs weitergeführt werden. Darüber hinaus ist die Ausgründung einer Firma zur Nutzung<br />
pilzlicher Bioressourcen geplant in der besonders vielversprechende Ansätze, die im Laufe des Bewilligungszeitraums<br />
erarbeitet wurden, zur Marktreife gebracht werden sollen.<br />
Wissenschaftliche Ziele / Publika tions ziele<br />
Ziel des <strong>LOEWE</strong>-Schwerpunktes Integrative Pilzforschung ist die Verknüpfung von pilzlicher Biodiversität<br />
(Projektbereich A) mit biotechnologischen Anwendungen (Projektbereich B) und molekulargenetischer<br />
Grundlagenforschung an Pilzen (Projektbereich C). In Projektbereich A wird die Pilzvielfalt in naturnahen<br />
Regionen in Hessen, China, La Reunion und Panama erfasst, unter Naturschutzaspekten bewertet, archiviert<br />
und konserviert und allen anderen Projektbereichen als Ressource zur Verfügung gestellt. Im Projektbereich<br />
B werden diese Pilze auf die Produktion biotechnologisch relevanter Substanzen (Antibiotika, Antioxidantien,<br />
Aromastoffe, Biotenside, polyungesättigte Fettsäuren, Pigmente) mittels analytisch chemischen Methoden<br />
untersucht. Anschließend werden Substanzen mit Anwendungspotenzial in größerem Maßstab isoliert,<br />
um diese hinsichtlich ihrer Eigenschaften zu testen und Industriepartnern zu weiteren Screenings zur Verfügung<br />
zu stellen. Zusätzlich sollen die Biosynthesewege dieser Substanzen aufgeklärt werden, um eine<br />
Produktion der gewünschten Substanzen in biotechnologischen Modellorganismen zu ermöglichen. Im<br />
Projektbereich C soll die Verbreitung und Evolution der aus einzelnen Modellpilzen bekannten Degenerationsprozessen<br />
und Stoffwechselwegen in den zugehörigen Artgruppen untersucht werden, um zu einem<br />
besseren Verständnis dieser Prozesse zu gelangen. Dieser Projektbereich profitiert vor allem von den<br />
Pilzvielfalt<br />
jüngsten Fortschritten der Genomforschung und Bioinformatik. Die hier gewonnenen Erkenntnisse sollen<br />
unter anderem genutzt werden, um neue und verbesserte Eigenschaften von Pilzstämmen zur Produktion<br />
biotechnologisch wichtiger Pilzinhaltsstoffe zu erzeugen. Anwendungsbereiche des <strong>LOEWE</strong>-Schwerpunkts<br />
IPF liegen somit in der Pharmazeutischen und kosmetischen Industrie (Therapeutika), der Nahrungsmittelindustrie<br />
(Kultivierung neuer Pilzarten, Nahrungsergänzungen) oder auch der Biotechnologie (Biotreibstoff,<br />
biologisch hergestellte Bausteine <strong>für</strong> chemische Prozesse).<br />
Neben diesen anwendungsorientierten Zielen sollen im Bewilligungszeitraum 85 Manuskripte veröffentlicht<br />
werden, davon 75 in international begutachteten Fachzeitschriften. Darüber hinaus soll ein Lehrbuch zur<br />
Mykologie erscheinen.<br />
Weitere Ziele<br />
Organisatorische Ziele/Kooperationsziele<br />
Der Schwerpunkt wird vom Leitungsgremium gesteuert, das aus den Koordinatoren (Prof. Dr. Thines und<br />
Prof. Dr. Bode), den Sprechern der Projektbereiche (Prof. Dr. Piepenbring, Frankfurt, PbA Biodiversität<br />
und Kultivierung; Prof. Dr. Zorn, Gießen, PbB Biochemie und Biotechnologie; Prof. Dr. Bölker, PbC Genetik<br />
und Genomik) und einem Vertreter der Nachwuchsgruppen besteht. Sprecher des Leitungsgremiums<br />
ist Prof. Dr. Thines. Die Sprecher der Projektbereiche sind <strong>für</strong> die Steuerung der jeweiligen drei Projektbereiche<br />
zuständig und koordinieren die Zusammenarbeit der darin zusammengefassten Projekte. Der<br />
IPF-Rat setzt sich aus den Projektleitenden und den Industriepartnern zusammen und koordiniert die<br />
Nutzbarmachung wissenschaftlicher Ergebnisse. Zusätzlich agiert ein wissenschaftlicher Beirat, der das<br />
Leitungsgremium des IPF berät. Für diesen konnten bereits Prof. Dr. Marc Stadler (Helmholtz-Zentrum<br />
<strong>für</strong> Infektionsforschung), Prof. Dr. Franz Oberwinkler (Eberhard Karls Universität Tübingen) und Prof. Dr.<br />
Paul Tudzynski (Westfälische Wilhelms-Universität Münster) gewonnen werden. Die Vernetzung innerhalb<br />
des Schwerpunkts IPF basiert auf gemeinsamen Treffen im Rahmen von Minisymposien (jährlich), Retreats<br />
(halbjährlich) und Workshops (jährlich). Diese sollen wechselnd an allen IPF-Standorten stattfinden, auch<br />
unter Beteiligung externer Sprecherinnen und Sprecher. Der Kooperationsvertrag zwischen den beteiligten<br />
Institutionen ist am 28. September <strong>2012</strong> in Kraft getreten.