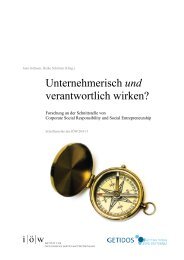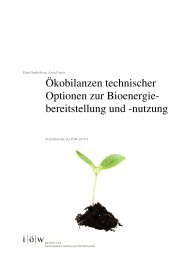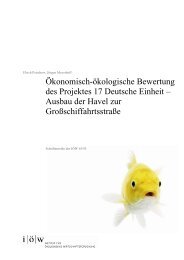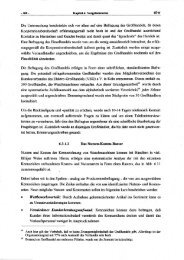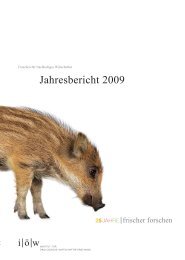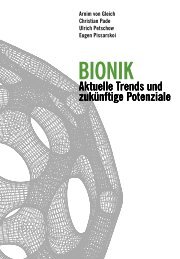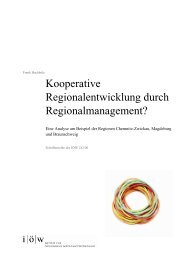INNOCOPE-Verfahren - Institut für ökologische Wirtschaftsforschung
INNOCOPE-Verfahren - Institut für ökologische Wirtschaftsforschung
INNOCOPE-Verfahren - Institut für ökologische Wirtschaftsforschung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
104 | E. HOFFMANN & W. KONRAD<br />
4.2 Erklärungsansätze <strong>für</strong> die beobachteten Lernerfolge<br />
Wir hatten in der Einleitung ausgeführt, dass neben den Interviews die teilnehmende Beobachtung<br />
während der drei Workshops ein wichtiges Element der Begleitforschung zum <strong>INNOCOPE</strong>-<br />
<strong>Verfahren</strong> war. Im Folgenden wird insbesondere auf diese Erhebungen zurückgegriffen, um Erklärungsversuche<br />
<strong>für</strong> die Lernerfolge zu entwickeln. Hierbei wird die Qualität des Interaktionsprozesses<br />
als Erklärung <strong>für</strong> das Lernen der Beteiligten diskutiert (Interaktionsparameter). Für die Untersuchung<br />
der Lernprozesse im Unternehmen werden zusätzlich Erklärungsansätze aus dem organisationalen<br />
Lernen und dem Boundary Spanning – ein Ansatz des organisationsübergreifenden<br />
Lernens und Interaktion (vgl. Hoffmann 2007) – herangezogen. Hier unterscheiden wir zwischen<br />
den Voraussetzungen im Unternehmen (Dispositionsparameter) und dem Durchlaufen verschiedener<br />
Phasen organisationalen Lernens (Prozessparameter). Wir diskutieren im Folgenden die in Abschnitt<br />
1.4.1 aufgeführten Einflussfaktoren auf Lernprozesse.<br />
4.2.1 Interaktionen: Zur Relevanz direkter und gleichberechtigter<br />
Kommunikationsprozesse<br />
Die Art und Weise, wie Akteure miteinander interagieren und kommunizieren, ist maßgeblich <strong>für</strong><br />
Lernprozesse, denn Lernen findet nicht im sozialen Vakuum, sondern in Auseinandersetzung mit<br />
anderen statt. Wir interessierten uns hinsichtlich der Interaktionen zwischen Konsument/innen und<br />
Unternehmensvertretern besonders <strong>für</strong> die Relevanz von direkten und gleichberechtigten Kommunikationsprozessen.<br />
In den Workshops traten die Konsument/innen und Unternehmensvertreter in einen direkten Austausch,<br />
was sich insbesondere in Kleingruppenphasen, aber auch in den Pausen zwischen einzelnen<br />
Workshop-Sessions zeigte. Die Moderation musste in den Arbeitseinheiten in Kleingruppen<br />
nur wenig eingreifen und konnte sich meist auf das Setzen von Impulsen, Erläuterung der Aufgabenstellung<br />
und Unterstützung der eingesetzten Methodik beschränken. Insgesamt beteiligten sich<br />
die Konsument/innen in größerem Umfang als die Unternehmensvertreter. Dies gilt auch <strong>für</strong> Workshop-Teile,<br />
die eine aktivere Beteiligung des Unternehmens ermöglicht hätten (z.B. Diskussionen<br />
zum Thema Klimaschutz). Die Unternehmensvertreter brachten sich dann besonders ein, wenn<br />
technische Expertenhinweise (z.B. zu Antrieb oder Reichweite) erforderlich schienen oder als es<br />
um die konkrete Ausgestaltung des zu entwickelnden Pedelecs ging. Diese Zurückhaltung einerseits<br />
und der zu bestimmten Anlässen intensivierte Dialog andererseits wurden von den Konsument/innen<br />
positiv als Ausdruck des Unternehmensinteresses an den Ideen der Nutzer/innen bewertet.<br />
In Bezug auf die gleichberechtigte Teilhabe zeigte sich ein ambivalentes Bild. Es konnte einerseits<br />
beobachtet werden, dass die Beiträge der Teilnehmenden gleichberechtigt formuliert werden konnten<br />
und die einzelnen Aussagen weitestgehend ernst genommen wurden. Andererseits konnten eine<br />
Reihe von Abwertungen von Redebeiträgen festgestellt werden. Hieran entzündeten sich jedoch<br />
keine den Gesamtprozess gefährdenden oder einzelne Personen an den Rand drängenden<br />
Gemengelagen. Im Gegenteil war der Wille zu erkennen, sich nicht irritieren zu lassen und weiterhin<br />
die eigene Meinung zu vertreten.<br />
Der geschäftsführende Unternehmensvertreter nahm insgesamt eine Expertenrolle ein; und zwar<br />
sowohl als selbst auferlegte Rolle (er bezeichnete sich einmal als „Meister des Fahrrades“) als<br />
auch als zugeschriebene Rolle durch die Konsument/innen. Dennoch wurden die Konsument/innen<br />
durch den Geschäftsführer zunehmend in ihren Ideen bestärkt („Das ist eine gute Idee“). Positiv