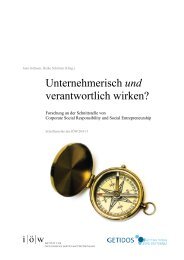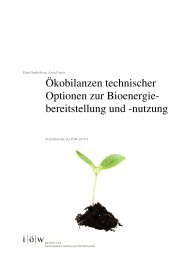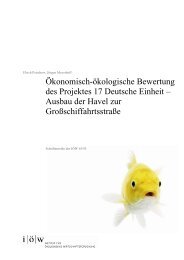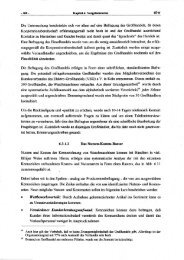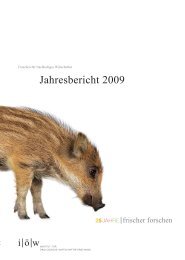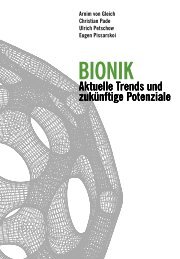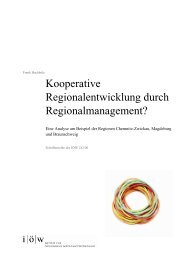INNOCOPE-Verfahren - Institut für ökologische Wirtschaftsforschung
INNOCOPE-Verfahren - Institut für ökologische Wirtschaftsforschung
INNOCOPE-Verfahren - Institut für ökologische Wirtschaftsforschung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
LERNEN UND NUTZER/INNENINTEGRATION | 77<br />
In der zweiten Befragung (Frage II.8) geben alle Befragten an, ihr Wissen über Methoden der<br />
Kundeneinbindung habe sich in der Zwischenzeit nicht verändert und es sei auch nicht geplant sich<br />
zusätzliche Kompetenzen anzueignen. Während einer der Befragten angibt, sich nicht auszukennen<br />
und es interessant fände, systematische Methoden kennen zu lernen, betont der Geschäftsführer,<br />
dass das, was dem Unternehmen bekannt ist, ausreicht: „Wozu hat man Wirtschaft studiert?<br />
Das, was man sich anliest und dann selbst betreibt, ist dann der Erkenntnisstand.“ (Interview<br />
2_2) In der dritten Befragungsrunde diese Frage nicht mehr gestellt, der Geschäftsführer zeigt jedoch<br />
in Fragen nach zukünftigen Möglichkeiten der Nutzer/inneneinbindung eine deutlich selbstkritischere<br />
Einschätzung (vgl. 3.4.7).<br />
In der dritten Befragung wurden die Unternehmensvertreter gefragt, was aus ihrer Sicht der wichtigste<br />
Beitrag sei, den Konsument/innen <strong>für</strong> die Produktentwicklung leisten könnten (Frage III.8).<br />
Alle Befragten verweisen auf das Einbringen von Erfahrungen und Problemen, die die Nutzer/innen<br />
im Umgang mit Produkten haben. Im Vordergrund steht hierbei das Erfahrungswissen im Umgang<br />
mit Produkten. Nutzer/innen können formulieren, was ihnen nicht gefällt. Der Geschäftsführer halt<br />
es zudem <strong>für</strong> sinnvoll, wenn sie ihre Bedürfnisse äußern. Im nächsten Schritt könnten dann die<br />
Entwickler/innen diese Aussagen gewichten und auf Verallgemeinerbarkeit prüfen und Lösungen<br />
entwickeln, die gegebenenfalls noch mal im Austausch mit Nutzer/innen überprüft werden könnten.<br />
Nur der Designer geht über die Rolle der Problembeschreiber/innen hinaus und sieht Nutzer/innen<br />
auch als Ideengeber/innen.<br />
Die Schwierigkeit und der Nutzen <strong>für</strong> das Unternehmen bestehen darin, die relevanten Aussagen<br />
herauszufiltern und umzusetzen. „Produkte sind meistens Kompromisslösungen“ (Interview 1_3)<br />
und hier geht es <strong>für</strong> das Unternehmen darum, zu bewerten, welche Aussagen auf eine Mehrheit<br />
von Kund/innen zutreffen.<br />
Während der Geschäftsführer Nutzer/innen vor allem in der Lage sieht, Aussagen zum Design zu<br />
machen, halten der Designer und der Produktmanager auch Aussagen zur Technik und technischem<br />
Verbesserungsbedarf <strong>für</strong> möglich. Der Produktmanager nennt zusätzlich die Preisvorstellungen<br />
von Kund/innen als interessante Information.<br />
In Bezug auf den Nutzertyp halten die Befragten „Extremnutzer“ (Interview 1_3) oder solche, die<br />
sich intensiv mit den Produkten beschäftigen, <strong>für</strong> besser in der Lage, relevante Anregungen <strong>für</strong><br />
Produktverbesserungen zu geben. Der Designer differenziert nach verschiedenen Produkten und<br />
beschreibt <strong>für</strong> die classic-Fahrräder normale Endverbraucher/innen als interessante Wissensgeber,<br />
die nützliche Aussagen zu Problemen wie Ergonomie, Alltagstauglichkeit, Fahrkomfort etc. machen<br />
können.<br />
Auf die Frage, ob sie neben Konsument/innen und Unternehmensvertreter/innen weitere Akteure in<br />
den Prozess der Produktentwicklung einbeziehen würden (Frage III.9) antworten zwei Befragte mit<br />
nein und der Designer mit ja. Der Designer hält die Einbeziehung von Händler/innen <strong>für</strong> sinnvoll,<br />
wobei er dies gleichzeitig in Frage stellt. Er vermutet, dass Händler/innen klare Vorstellungen von<br />
Fahrrädern haben, die nicht unbedingt mit denen der Nutzer/innen übereinstimmen. Hier bieten<br />
Workshops mit Händler/innen und Nutzer/innen die Chance mit falschen Vorstellungen aufzuräumen.<br />
Gleichzeitig be<strong>für</strong>chtet er, dass Händler/innen die Nutzer/innen bevormunden und diese nicht<br />
dazu kommen, ihre Meinung und Ideen einzubringen: „Der Händler wird den Endverbraucher<br />
schnell abstempeln: der hat ja sowieso keine Ahnung von Fahrrädern, da kommt nichts Interessantes.“<br />
(Interview 1_3) Zudem sieht er im Fahrradhandel ein breites Spektrum von innovativ bis konservativ<br />
und hält es <strong>für</strong> schwierig geeignete Händler/innen auszusuchen.<br />
Die beiden anderen sind der Ansicht, dass ein Unternehmen in Interaktion mit Kund/innen die relevanten<br />
Informationen über Kundenwünsche erhält und weitere Akteure nicht notwendig sind. Der<br />
Geschäftsführer erläutert, dass der Markterfolg eines Produktes neben der Passgenauigkeit zu