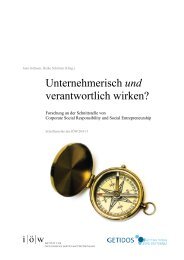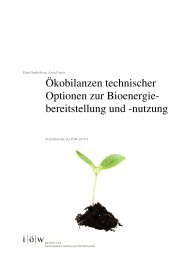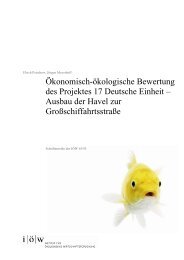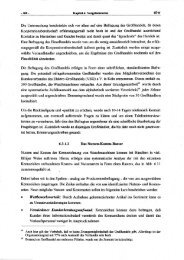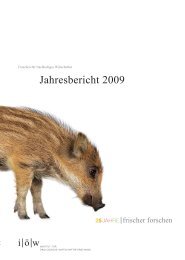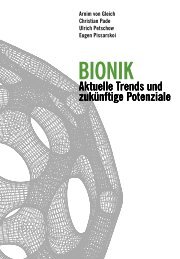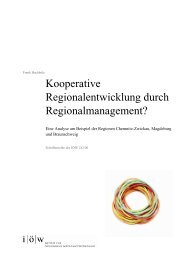INNOCOPE-Verfahren - Institut für ökologische Wirtschaftsforschung
INNOCOPE-Verfahren - Institut für ökologische Wirtschaftsforschung
INNOCOPE-Verfahren - Institut für ökologische Wirtschaftsforschung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
12 | E. HOFFMANN & W. KONRAD<br />
In Anlehnung an die Definition nachhaltiger Entwicklung wird Konsum als nachhaltig bezeichnet,<br />
wenn er „zur Bedürfnisbefriedigung der heute lebenden Menschen beiträgt, ohne die Bedürfnisbefriedigungsmöglichkeiten<br />
zukünftiger Generationen zu beeinträchtigen“ (Hansen & Schrader 2001:<br />
21f.). 2 In einem reflexiv-dynamischen Verständnis ist nachhaltiger Konsum zudem gekennzeichnet<br />
durch die Fähigkeit der Konsument/innen zur Reflexion eigener Bedürfnisse und eigenem Handelns<br />
im Hinblick auf soziale, <strong>ökologische</strong> und ökonomische Folgen der Bedürfnisbefriedigung. Die<br />
Förderung nachhaltigen Konsums muss daher über Informationsbereitstellung und Verhaltensanreize<br />
hinausgehen und die Reflexionsfähigkeit fördern sowie Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten<br />
eröffnen (Empowerment). Dies erfordert bei der Strategieentwicklung einen lernorientierten<br />
Ansatz sowie die Zusammenarbeit mit Stakeholdern (Jackson & Michaelis 2003).<br />
Die Einbeziehung von Konsument/innen in die Produktentwicklung kann dazu beitragen, dass sie<br />
ihre Konsumgewohnheiten reflektieren, sich bewusst mit Bedürfnissen, Produkten, Nutzungsformen<br />
und Umweltfolgen auseinandersetzen und neue Handlungsoptionen erkennen. Eine aktive<br />
Gestaltungsmacht in technischen Entwicklungsprozessen kann zu einem Empowerment der Konsument/innen<br />
beitragen (Weller 1999), das zu neuem Wissen und Handlungskompetenz sowie allgemein<br />
zu verbesserten Fähigkeiten bei der Vertretung eigener Interessen in gesellschaftlichen<br />
Prozessen führt (Rohracher 1999).<br />
Gerade im Zusammenhang mit nachhaltigen Produktinnovationen wird eine aktive Rolle von Nutzer/innen<br />
be<strong>für</strong>wortet, da sie häufig mit Verhaltensveränderungen verbunden sind und daher ebenso<br />
an Nutzer/innen- wie an Marktanforderungen angepasst sein sollten (Väyrynen et al. 2002b;<br />
Heiskanen et al. 2005). Wird Alltags- und Nutzungswissen mit dem Fachwissen der Produktentwicklung<br />
kombiniert kann Nutzer/inneneinbindung zu wechselseitigem Lernen, technischen Innovationen<br />
und nachhaltigen Veränderungen in Konsum- und Produktionsmustern beitragen.<br />
1.1 Bestehende Methoden der Beteiligung von<br />
Nutzer/innen an der Produktentwicklung<br />
Im Blick auf die Entwicklung eines partizipativen, Nachhaltigkeitsaspekte integrierenden Produktentwicklungsverfahrens<br />
im Rahmen des GELENA-Projekts wurden Methoden von und Erfahrungen<br />
mit bestehenden Beteiligungsverfahren aufgearbeitet. Sechs Partizipationskonzepte erwiesen sich<br />
als besonders instruktiv <strong>für</strong> die partizipative Produktentwicklung im Nachhaltigkeitsbereich:<br />
– Produktklinik und Fokusgruppen (Nowak 1983; Burmann 1987; Schuh 1991; Heß 1997;<br />
Greenbaum 1998);<br />
– Lead User Methode (Hippel 1986; Urban & Hippel 1988; Herstatt 1991; Herstatt & Hippel 1992;<br />
Lüthje 2000; Herstatt et al. 2003);<br />
– Script Approach (Jelsma 1999; Jelsma 2001; Kroode & Zee 2001);<br />
2 Ähnliche Definitionen finden sich bei Scherhorn 1996, Reisch & Scherhorn 1998, UBA 2002, Brand et al. 2002, Brand<br />
et al. 2003, Belz & Bilharz 2005.