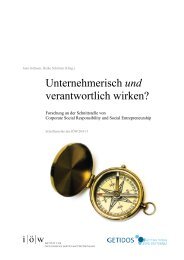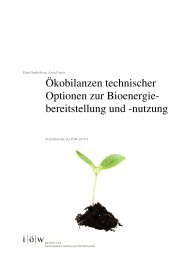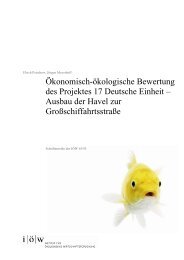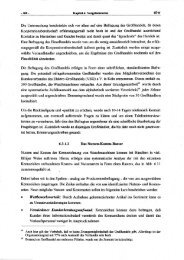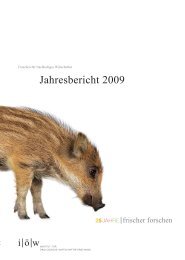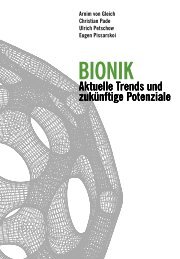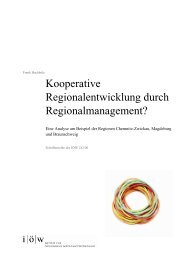INNOCOPE-Verfahren - Institut für ökologische Wirtschaftsforschung
INNOCOPE-Verfahren - Institut für ökologische Wirtschaftsforschung
INNOCOPE-Verfahren - Institut für ökologische Wirtschaftsforschung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
108 | E. HOFFMANN & W. KONRAD<br />
Workshops wurden im Unternehmen in Produktentwicklungsbesprechungen weiter gegeben und<br />
damit an relevante Akteure verteilt. Der Wissensdiffusionsprozess fand jedoch mit zeitlicher Verzögerung<br />
statt: während in der zweiten Befragung (kurz nach Ende von <strong>INNOCOPE</strong>) noch alle Befragten<br />
angaben, das neue Wissen sei nicht weiter gegeben worden, hatte sich das Bild in der dritten<br />
Befragung (knapp 1 Jahr nach <strong>INNOCOPE</strong>) gewandelt, denn alle Befragten geben an, dass<br />
neue Erkenntnisse aus den Workshops in Produktentwicklungsprozesse eingespeist wurden. Dies<br />
gilt jedoch nur <strong>für</strong> die unmittelbar produktbezogenen Anforderungen, denn die Ideen der Konsument/innen<br />
zu Marketing wurden im Unternehmen nicht verbreitet. In Bezug auf die Diffusion in<br />
Entwicklungsprozesse wirkte sich positiv aus, dass alle drei Unternehmensvertreter, die an den<br />
<strong>INNOCOPE</strong>-Workshops teilnahmen, in die Produktentwicklung eingebunden sind. Das Marketing<br />
hingegen wird von einem anderen Mitarbeiter ausgeführt, der mit den Workshops und -ergebnissen<br />
nicht in Berührung kam. Dies entspricht der Erkenntnis von Nonaka (1994), dass Teams und<br />
Teamarbeit eine wichtige Rolle in der Wissensverteilung zukommt, da diese die Verteilung von implizitem<br />
Wissen ermöglichen.<br />
Wissensinterpretation fand in den Workshops, zugleich aber auch im Anschluss daran statt. In den<br />
Workshops ließ sich beobachten, dass die Unternehmensvertreter die Konsument/innen um Erläuterungen<br />
ihrer Äußerungen und Wünsche baten, um diese besser zu verstehen. So fragte zum<br />
Beispiel der Designer bei der Bewertung des Prototypen im dritten Workshop intensiv nach Erläuterungen<br />
der Eindrücke und Gefühle der Konsument/innen. Implizites Nutzungswissen der Konsument/innen<br />
wurde, wie oben ausgeführt, insbesondere in den kreativen Phasen des zweiten Workshops<br />
erschlossen, in dem die Konsument/innen zunächst die Nutzung von Pedelecs beschrieben<br />
und ausmalten und hieraus Produktanforderungen und -eigenschaften ableiteten. Dieser Übersetzungsprozess<br />
erfolgte in Zusammenarbeit von Unternehmensvertretern und Konsument/innen. Auf<br />
Basis der Workshop-Erkenntnisse entwickelten die Unternehmensvertreter in den Workshops und<br />
im Anschluss daran Vorstellungen von Konsument/innen, ihrem Verhalten und ihren Anforderungen<br />
(Mapping), die teilweise mit den Darstellungen der Konsument/innen übereinstimmen, teilweise<br />
aber auch davon abweichen.<br />
In den Workshops gab es explizite Phasen der Bewertung von entwickelten Ideen, in denen allerdings<br />
mit einer Ausnahme die Konsument/innen die Diskussion bestimmten. Das Unternehmen hat<br />
daher im Anschluss an die Workshops <strong>für</strong> sich bewertet, welche Ideen interessant <strong>für</strong> die Umsetzung<br />
erscheinen. Die Wissensbewertung erfolgte allerdings nicht systematisch, sondern eher implizit<br />
und aus dem Bauch heraus. Die als relevant bewerteten Anforderungen wurden in der Produktentwicklung<br />
(des Pedelec und weiterer Fahrräder) umgesetzt (Wissensanwendung). Veränderungen<br />
in Prozessen resultierten nicht aus der Teilnahme an <strong>INNOCOPE</strong>.<br />
Einzig die Phase der Wissensspeicherung konnte nicht festgestellt werden. Jenseits der im Prozess<br />
durch das Forschungsteam erstellten Dokumente (Workshopkonzepte und -dokumentationen)<br />
fand keine schriftliche Ergebnissicherung statt. Die Ergebnisse sind gemäß den befragten Unternehmensvertretern<br />
„in den Köpfen der Beteiligten gespeichert“. Allerdings scheint der Geschäftsführer<br />
ein zentraler Teil des organisationalen Gedächtnisses zu sein. Die Speicherung in den Köpfen<br />
genügte, um die Erkenntnisse in aktuell laufende Entwicklungsvorhaben einzuspeisen, inwieweit<br />
sie <strong>für</strong> spätere Entwicklungen verfügbar bleiben, ist fraglich.<br />
Der organisationale Lernprozess ist damit, abgesehen von der Phase Wissensspeicherung, vollständig<br />
durchlaufen. Dennoch konnten wir nur zu einem Teil der Lernziele Erfolge feststellen, was<br />
darauf hindeutet, dass neues Wissen nur zu ausgewählten Themen aufgegriffen und verarbeitet<br />
wurde. Zusätzlich wirft dies die Frage auf, ob das Durchlaufen verschiedener organisationaler<br />
Lernphasen eine hinreichende Bedingung <strong>für</strong> organisationalen Lernerfolg ist.