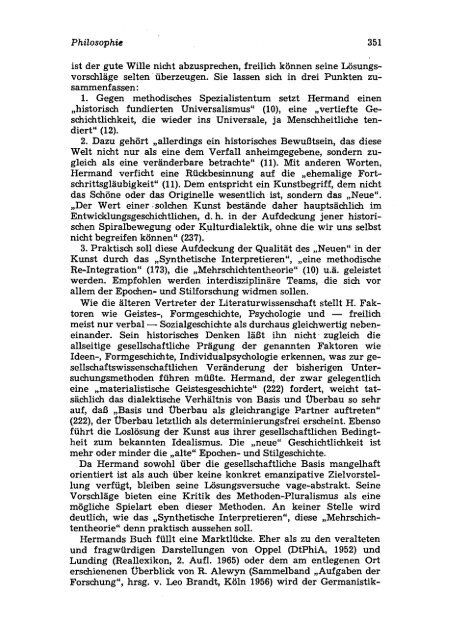Das Argument 72 - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Das Argument 72 - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Das Argument 72 - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Philosophie 351<br />
ist der gute Wille nicht abzusprechen, freilich können seine Lösungsvorschläge<br />
selten überzeugen. Sie lassen sich in drei Punkten zusammenfassen:<br />
1. Gegen methodisches Spezialistentum setzt Hermand einen<br />
„historisch fundierten Universalismus" (10), eine „vertiefte Geschichtlichkeit,<br />
die wieder ins Universale, ja Menschheitliche tendiert"<br />
(12).<br />
2. Dazu gehört „allerdings ein historisches Bewußtsein, das diese<br />
Welt nicht nur als eine dem Verfall anheimgegebene, sondern zugleich<br />
als eine veränderbare betrachte" (11). Mit anderen Worten,<br />
Hermand verficht eine Rückbesinnung auf die „ehemalige Fortschrittsgläubigkeit"<br />
(11). Dem entspricht ein Kunstbegriff, dem nicht<br />
das Schöne oder das Originelle wesentlich ist, sondern das „Neue".<br />
„Der Wert einer solchen Kunst bestände daher hauptsächlich im<br />
Entwicklungsgeschichtlichen, d. h. in der Aufdeckung jener historischen<br />
Spiralbewegung oder Kulturdialektik, ohne die wir uns selbst<br />
nicht begreifen können" (237).<br />
3. Praktisch soll diese Aufdeckung der Qualität des „Neuen" in der<br />
Kunst durch das „Synthetische Interpretieren", „eine methodische<br />
Re-Integration" (173), die „Mehrschichtentheorie" (10) u.ä. geleistet<br />
werden. Empfohlen werden interdisziplinäre Teams, die sich vor<br />
allem der Epochen- und Stilforschung widmen sollen.<br />
Wie die älteren Vertreter der Literaturwissenschaft stellt H. Faktoren<br />
wie Geistes-, Formgeschichte, Psychologie und — freilich<br />
meist nur verbal — Sozialgeschichte als durchaus gleichwertig nebeneinander.<br />
Sein historisches Denken läßt ihn nicht zugleich die<br />
allseitige gesellschaftliche Prägung der genannten Faktoren wie<br />
Ideen-, Formgeschichte, Individualpsychologie erkennen, was zur gesellschaftswissenschaftlichen<br />
Veränderung der bisherigen Untersuchungsmethoden<br />
führen müßte. Hermand, der zwar gelegentlich<br />
eine „materialistische Geistesgeschichte" (222) fordert, weicht tatsächlich<br />
das dialektische Verhältnis von Basis und Überbau so sehr<br />
auf, daß „Basis und Überbau als gleichrangige Partner auftreten"<br />
(222), der Überbau letztlich als determinierungsfrei erscheint. Ebenso<br />
führt die Loslösung der Kunst aus ihrer gesellschaftlichen Bedingtheit<br />
zum bekannten Idealismus. Die „neue" Geschichtlichkeit ist<br />
mehr oder minder die „alte" Epochen- und Stilgeschichte.<br />
Da Hermand sowohl über die gesellschaftliche Basis mangelhaft<br />
orientiert ist als auch über keine konkret emanzipative Zielvorstellung<br />
verfügt, bleiben seine Lösungsversuche vage-abstrakt. Seine<br />
Vorschläge bieten eine Kritik des Methoden-Pluralismus als eine<br />
mögliche Spielart eben dieser Methoden. An keiner Stelle wird<br />
deutlich, wie das „Synthetische Interpretieren", diese „Mehrschichtentheorie"<br />
denn praktisch aussehen soll.<br />
Hermands Buch füllt eine Marktlücke. Eher als zu den veralteten<br />
und fragwürdigen Darstellungen von Oppel (DtPhiA, 1952) und<br />
Lunding (Reallexikon, 2. Aufl. 1965) oder dem am entlegenen Ort<br />
erschienenen Überblick von R. Alewyn (Sammelband „Aufgaben der<br />
Forschung", hrsg. v. Leo Brandt, Köln 1956) wird der Germanistik-