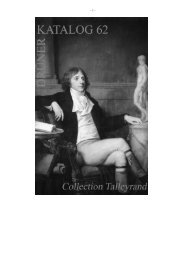Katalog 67 Fertig.qxp - Musikantiquariat Dr. Ulrich Drüner
Katalog 67 Fertig.qxp - Musikantiquariat Dr. Ulrich Drüner
Katalog 67 Fertig.qxp - Musikantiquariat Dr. Ulrich Drüner
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
- 116 -<br />
leicht jenen, dessen nicht erkennbarer Namenszug gleichfalls auf der Titelseite zu finden ist)<br />
und in Zusammenhang mit einer (Konzert-?) Reise nach Berlin eingetragen worden.<br />
Zu 1: Schönbergs Pelleas und Melisande ist sein erstes, mit ca. 3/4 Stunden Dauer umfangreichstes<br />
und zugleich einziges tonales Werk für großes Orchester (hier 17 Holz- und 18<br />
Blechbläser sowie 2 Harfen und 64 Streicher sowie größeres Schlagwerk). Es entstand zwischen<br />
Sommer 1902 und Anfang 1903und ist ein äußerst komplexes, selbst für jene Zeit<br />
außergewöhnlich polyphones Werk, das auch die differenzierte Orchestertechnik eines<br />
Richard Strauss weit hinter sich lässt. Schönberg selbst hat keine programmatischen<br />
Hinweise in den Notentext eingefügt, doch gibt es von Alban Berg eine detaillierte Analyse,<br />
in der er nicht nur die verborgenen Strukturen einer viersätzigen Sinfonie herausarbeitet,<br />
sondern auch auf den Inhalt eingeht, der mit leitmotivischer Technik verschiedene Schauplätze<br />
von Maeterlincks <strong>Dr</strong>ama widerspiegelt (z. B. zu Beginn eine Waldszene, später das<br />
durch die hier erstmals verwendeten Posaunenglissandi angedeuteten Abstieg der Brüder<br />
Gollaud und Pelleas in die Kellergewölbe oder als „Finale“ Melisandes Tod). Uraufführung:<br />
Wien, 26. Januar 1905 unter der Leitung des Komponisten.<br />
Zu 2: Nach den orchestralen „Exzessen“ von Pelleas und Melisande, welche die Schwelle<br />
von der Spätromantik zum beginnenden Expressionismus und der Atonalität markieren, zog<br />
sich Schönberg mit der Kammersymphonie vom äußerlichen Aufwand her zwar zurück,<br />
behielt aber den freitonalen Satz, die gesteigerte Polyphonie und die rhythmische Vielschichtigkeit<br />
bei. Auch hier blieb die viersätzige Struktur erhalten, obwohl das Ganze ohne<br />
Pausen verschmolzen ist. Trotz unverkennbar „schmachtender“ Tristan-Anleihen herrscht<br />
ein spröderer Klang vor, den Schönberg in einer späteren Bearbeitung für großes Orchester<br />
wieder etwas abmilderte. – Zur Verwirklichung der kammermusikalischen Version legte<br />
Schönberg eine genaue Sitzordnung des Ensembles fest, die er vor den Beginn der Partitur<br />
einfügte. Uraufführung: 8. Februar 1907 in Wien unter Mitwirkung des Rosé-Quartetts und<br />
der Bläservereinigung der Wiener Philharmoniker.<br />
Zu 3: In diesen fünf Stücken griff Schönberg wieder auf das erweiterte spätromantische<br />
Orchester zurück (mit Harfe, Celesta, großem Schlagwerk), doch nun ist der entscheidende<br />
Schritt in die atonale Setzweise vollzogen. Zudem reduziert er den Umfang der Sätze drastisch,<br />
eine Tendenz, deren Gipfelpunkt in Anton Weberns minimalistischen Werken zu finden<br />
ist (dieser bezeichnete Schönbergs op. 16 später als „Prosa der Musik“). In der vorliegenden,<br />
wohl frühesten Ausgabe fehlen noch die programmatischen Titel, die Schönberg<br />
auf Anraten des Verlegers den Sätzen der Ausgabe von 1922 beigegeben hat: 1. Vorgefühle;<br />
2. Vergangenes; 3. Farben; 4. Peripetie; 5. Das obligate Rezitativ. – Uraufführung: 3. September<br />
1912 in London unter der Leitung von Henry Wood.<br />
1<strong>67</strong>. SCHREKER, Franz (1878–1934). Der Schatzgräber. Oper in einem Vorspiel, vier<br />
Aufzügen und einem Nachspiel. Wien, Universal Edition, Verl.-Nr. 6136, © 1919. 296 S.<br />
Klavierauszug, folio, OBroschur. € 250,—<br />
Erstausgabe mit der märchenhaften Titellithographie von Richard Teichner: Zwei Spielleute,<br />
über denen in einer Lohe Els in phantastisch-erotischer Gewandung schwebt. – Der<br />
Schatzgräber ist „der Stadt Frankfurt am Main und ihrem Opernhaus in Dankbarkeit zugeeignet“,<br />
wo das Werk am 21. Januar 1920 uraufgeführt worden ist. Schnell entwickelte es<br />
sich zu Schrekers populärster Oper, zu der er – wie zu seinen anderen Bühnenwerken – das<br />
Libretto selbst geschrieben hat. Neben Richard Strauss war er der meistgespielte deutsche<br />
Opernkomponist seiner Zeit; nach der „Machtergreifung“ wurden seine Werke sofort verbo-