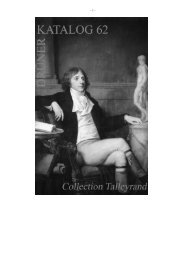Katalog 67 Fertig.qxp - Musikantiquariat Dr. Ulrich Drüner
Katalog 67 Fertig.qxp - Musikantiquariat Dr. Ulrich Drüner
Katalog 67 Fertig.qxp - Musikantiquariat Dr. Ulrich Drüner
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
- 123 -<br />
chene Opferfest, welche am 14. Juni 1796 in Wien uraufgeführt worden war (wo Winter sich<br />
1794 bis 1798 aufhielt) und die sich in den europäischen Spielplänen rasch etablierte.<br />
Zugleich entbehrt es nicht einer gewissen Komik, dass ausgerechnet Winter diesen Auftrag<br />
erhielt, weil Mozart ihn als „meinen größten Feind“ bezeichnet hatte (Brief vom 22. 12.<br />
1781). – Der Zweite Theil weist zahlreiche Beziehungen zu Mozarts Zauberflöte auf: Der<br />
Verfasser des Librettos und einige Sänger sind wieder dabei (Josepha Hofer jeweils als<br />
Königin der Nacht, Schikaneder nicht nur als Librettist, sondern auch als Papageno); erneut<br />
ist das Glockenspiel zu vernehmen, und der Flöte kommt wieder eine besondere Rolle zu.<br />
Auch Sarastro, Papagena, die drei Damen und Monostatos sind da. Schikaneder vertiefte die<br />
spaßige Sphäre des „niedrigeren Paares“ auf Kosten der Handlungsbedeutung von Tamino<br />
und Pamina, und wieder ist die Handlung ganz auf Theatereffekte angelegt, bei denen die<br />
Bühnenmaschinerie zur Geltung kommt. – Auch wenn die Uraufführung am 12. Juni 1798<br />
in Wien zunächst eine geteilte Pubklikumswirkung hatte, war auch das Labyrinth wenigstens<br />
eine zeitlang erfolgreich. 1930 wurde das Werk in neuer Bearbeitung unter dem Titel<br />
Papagenos Hochzeit wiederbelebt, doch bereits zur Entstehungszeit wirkte es sich auf<br />
Goethe derart aus, dass dieser seine eigene Bemühungen um eine „zweite Zauberflöte“<br />
abbrach, obwohl sich Zelter 1803 anlässlich der Berliner Aufführungen des Labyrinths eher<br />
kritisch gezeigt hatte: „Das Stück wird hier mit ganz außerordentlichem Pomp und<br />
Theateraufwand gegeben.“ Die Dekorationen „sind so faselhaft und pfuscherhaft zusammengesetzt<br />
und so schlecht gealtert, dass man das Gesicht mit Verdruss wegwendet ...“ Die<br />
Musik sei „voll von Effekten“, die „das Ohr und den Sinn betäuben und überrennen“, und<br />
werde durch „eine unzählbare Menge neuer Dekorationen, Luft- und Erderscheinungen“<br />
übertüncht. Es handle sich um ein „vier Stunden langes Kinderspiel“, und das Libretto sei<br />
„von der unbegreiflichsten Schlechtigkeit“. Ob bei diesem Urteil nicht eher norddeutsche<br />
Opern-Skepsis und Wiener Theater-Sinnlichkeit aufeinanderprallen, sei dahingestellt. –<br />
Winter hatte sich schon an einer früheren Oper in der „Zauberflöten-Tradition“ beteiligt,<br />
nämlich mit dem 2. Akt von Babylons Pyramiden (Libretto wieder von Schikaneder), die<br />
am 25. Oktober 1797 in Wien uraufgeführt worden ist (1. Akt von J. Mederitsch „Gallus“).