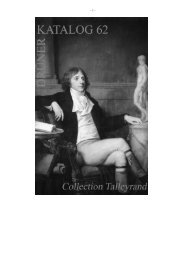Katalog 67 Fertig.qxp - Musikantiquariat Dr. Ulrich Drüner
Katalog 67 Fertig.qxp - Musikantiquariat Dr. Ulrich Drüner
Katalog 67 Fertig.qxp - Musikantiquariat Dr. Ulrich Drüner
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
- 35 -<br />
C) Neueres, mindestens ebenso Wichtiges<br />
Die erste Theorie der atonalen Musik<br />
48. HAUER, Josef Matthias (1883–1959). Vom Wesen des Musikalischen. Leipzig/Wien,<br />
Waldheim-Eberle, 1920. 66 S., 3 unpag. Bll. mit drei Tafeln, 8vo. OBrosch. mit der originalen<br />
Werbebanderole (als Blickfang mit der Aufschrift in großen Lettern: Das erste theoretische<br />
Werk über die atonale Musik in Europa mit einer Tafel und Notenbeispielen im<br />
Text). Allgemein deutliche Alterungsspuren (gebräuntes Papier, kleinere Schäden am<br />
Papierumschlag). Auf der Haupttitelseite (unten) getilgter Besitzvermerk (dadurch verursachter<br />
Blattschaden mit Papierstreifen hinterlegt). € 250,—<br />
Erstausgabe. – Noch vor Schönberg hatte Hauer 1919 die Zwölftontechnik (allerdings in<br />
einer eigenen Ausprägung) entwickelt. Als zusammenhängende Theorie ist sie in der vorliegenden<br />
Schrift veröffentlicht, die somit als frühestes Lehrwerk dieser Stilrichtung zu gelten<br />
hat. Hauer stellt hier auch seine neue Notation vor (acht, in ihrer Struktur an den Tasten des<br />
Klaviers orientierte Linien), um die unzähligen, bei atonaler Musik notwendigen<br />
Akzidentien zu vermeiden. – Hauer geht hier ganz selbstverständlich vom Ende der traditionellen<br />
Musik aus; er erklärt zur atonalen Melodie, dass sie „dem heutigen Musikschaffen<br />
als Formprinzip zugrunde liegt“, und dass sie die „alten ‚Auflösungen’ und<br />
‚Fortschreitungen’ in die <strong>Dr</strong>eiklänge vollständig“ ignoriert. Für sie „gelten die Gesetze der<br />
Konsonanz und Dissonanz [...] nicht mehr; sie schafft sich ihre Spannungs- und<br />
Entspannungspunkte ganz von selbst, aus sich heraus und unabhängig von den physikalisch<br />
physiologischen (‚natürlichen’) Verhältnissen der Obertonreihe...“ Die Schlussfolgerung ist<br />
ebenso konsequent, wie in ihrer Aussagekraft ambivalent: „Die atonale Melodie ist gewiß<br />
von der ‚Natur’ weit entfernt, dafür aber, wenn sie echt ist, etwas rein Geistiges,<br />
Musikalisches – die ‚Melodie’ kat exochen.“ Zu ihrem Vortrag seien allerdings Instrumente<br />
mit temperierter Stimmung (also Klavier oder Harmonium) geeignet. Verblüffend ist eine<br />
hier neu formulierte, mit Farbassoziationen und Goethe-Zitaten verknüpfte Qualifizierung<br />
der Tonarten, wonach beispielsweise Fis-Dur als „prometheischer Ton; komplementär zu C“<br />
oder G-Dur als „Biedermeierton“ charakterisiert wird. Auf der letzten der angehängten<br />
Tafeln ist dies in der Form eines Farbkreises nochmals übersichtlich dargestellt, wobei<br />
durchaus traditionelle Vorstellungen zum Tragen kommen, wenn die Eigenschaften für C<br />
mit „Sieg, rein, olympisch, jungfräulich, glänzend, festlich“ umschrieben sind.<br />
Pfitzners Rundumschläge gegen die Moderne<br />
49. PFITZNER, Hans (1869–1949). Futuristengefahr. Bei Gelegenheit von Busoni’s Ästhetik.<br />
Leipzig-München, Süddeutsche Monatshefte, 1917. 48 S., klein 8vo. OBroschur m.<br />
Altersspuren, gelockert. teils gelöst, doch insgesamt gut erhalten. € 160,—<br />
Erstausgabe. – Die erste von Pfitzners immer aggressiver werdenden konservativen<br />
Streitschriften, die hier gegen Busonis Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst gerichtet<br />
ist und der 1920 Die neue Ästhetik der musikalischen Impotenz (s. Kat.-Nr. 12) sowie 1940<br />
Über musikalische Inspiration (s. Kat.-Nr. 139) folgten – erstere eine Abrechnung mit Paul<br />
Bekker, die zweite mit Julius Bahle. – Pfitzner versäumte kaum eine Gelegenheit zur heftigen<br />
Auseinandersetzung mit seinen Kontrahenten (oder denen, die er dafür hielt), und so<br />
erklärt er zu Beginn ganz unschuldig: „Es ist mir selbst nicht leicht, herauszufinden, weshalb<br />
ich mich überhaupt dazu äußern will.“ Doch rasch gesteht er ein, „daß ich mit dem<br />
Inhalt des Busonischen Schriftchens nicht sympathisiere“. Dessen geforderte Abkehr von