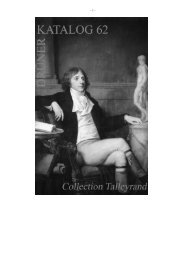Katalog 67 Fertig.qxp - Musikantiquariat Dr. Ulrich Drüner
Katalog 67 Fertig.qxp - Musikantiquariat Dr. Ulrich Drüner
Katalog 67 Fertig.qxp - Musikantiquariat Dr. Ulrich Drüner
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
- 61 -<br />
Zu WWV 90. – Vor allem seine mittleren und späten Musikdramen suchte Wagner schon<br />
vor der Uraufführung wenigstens ausschnittweise bekannt zu machen und stellte hierfür<br />
(trotz widersprüchlicher ästhetischer Überzeugungen) so genannte „Konzertfassungen“ von<br />
einzelnen ihm geeignet erscheinenden Teilen her; je nach Charakter des gewählten Stücks<br />
benötigte er dafür Einleitungen und/oder einige abschließende Takte. So hoffte er, das<br />
Publikum mit seinem sich immer mehr von der traditionellen Musik unterscheidenden Stil<br />
vertraut zu machen. Auch unser Blatt gehört zu diesen Arbeiten und dokumentiert zugleich<br />
die letzte Vorstufe von Wagners auch heute noch meistgespielter Orchesterkomposition,<br />
dem Vorspiel und Liebestod aus Tristan und Isolde. Während aber dort durch die<br />
Anfügung des Schlusses zum dritten Akt eine quasi-symphonische Einheit entstand, ging es<br />
im Stadium unseres hier vorliegenden Blattes zunächst nur um das Vorspiel.<br />
Im Vorfeld eines Auftritts in Prag erkundigte sich Hans von Bülow am 5. Februar 1859 bei<br />
Wagner, ob dieser davon nicht eine Konzertfassung anfertigen wolle, die er dann dort aufführen<br />
könne. „Willst Du das Tristan-Vorspiel in Prag aufführen, so habe ich nichts dagegen“,<br />
antwortete Wagner am 10. Februar; „nur musst Du dann selbst einen Schluss dazu<br />
machen. Von mir kannst Du das nicht verlangen.“ Doch zeigte sich Wagner mit Bülows<br />
Arbeit nicht zufrieden, obwohl er an deren Entstehung selbst verantwortlich war. Am 8.<br />
März rügt er ihn recht harsch: „In den Schluss zum Vorspiel kann ich mich nicht finden,<br />
bereue überhaupt, Dir meine Einwilligung gegeben zu haben.“ Doch da war es zu spät – der<br />
Brief traf bei Bülow wohl erst nach dem Konzert am 12. März ein.<br />
Als Wagner Anfang 1860 in Paris eigene Konzerte plante, stellte er selbst eine neue Version<br />
her, für die er aber ein erst jetzt mögliches Ergebnis fand. Als er am 19. Dezember 1859<br />
Mathilde Wesendonck von Bülows verunglückter Bearbeitung berichtet, erklärt er dann:<br />
„Seitdem habe ich nun den dritten Act geschrieben und den vollen Schluss des Ganzen<br />
gefunden: diesen Schluss als dämmernde Ahnung der Erlösung im Voraus zu zeigen, fiel mir<br />
nun ein, als ich ein Conzert in Paris entwarf.“ Somit spielte selbst bei der Einrichtung des<br />
Vorspiels das Ende des Musikdramas bereits eine entscheidende Rolle, und unser<br />
Autograph enthält dessen spätestes Entwurfsstadium (eben das Particell). Die<br />
Niederschrift umfasst eine Seite in vier Akkoladen zu je vier Systemen (bei der letzten<br />
wurde ein fünftes angefügt) und erstreckt sich über 26 Takte. Es handelt sich um eine zügige,<br />
weitgehend ohne Korrekturen auskommende Notation, die fast Reinschriftcharakter mit<br />
gelegentlichen Instrumentierungsanga-ben aufweist. Nur an wenigen Stellen wurden kleine<br />
Änderungen nötig, von denen die meisten mit der gleichen Tinte (und damit wohl im frühesten<br />
Arbeitsgang) ausgeführt sind; hinzu kommen in den Takten 2, 6 und 11 flüchtige<br />
Bleistifteintragungen, die schwer zu deuten sind (im 3. Takt wurden solche Ergänzungen<br />
radiert und sind nicht mehr zu rekonstruieren).<br />
Provenienz: Das Blatt war einst im Besitz von Arturo Toscanini (18<strong>67</strong>–1957); Siegfried<br />
Wagner hatte es ihm 1930/31 geschenkt, um den Maestro möglichst eng an Bayreuth zu binden.<br />
Später ging das Blatt durch die Hände des Antiquars und Sammlers Rudolf Kallir<br />
(1896–1987) und befand sich seit 1979 im Besitz des Sammlers, Komponisten und Arztes<br />
Friedrich Georg Zeileis (geb. 1939).<br />
Lit.: F. G. Zeileis, <strong>Katalog</strong> einer Musiksammlung, Gallspach, 1992, S. 184f.; Abb. S. 235.<br />
R. Kallir, Erinnerungen. Zürich, Atlantis 1977; S. 81 wird auf Toscaninis Vorbesitz eingegangen.