Hochgesangs Wandlungen des Dichtstils - Leben und Werk des ...
Hochgesangs Wandlungen des Dichtstils - Leben und Werk des ...
Hochgesangs Wandlungen des Dichtstils - Leben und Werk des ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
I l0<br />
Die Sprnche<br />
Dotothea'l'ieck<br />
ll7<br />
T. IV/lll. Nicht stürmte der Tyrann in ihren<br />
Frieden ?<br />
Es kommt auch die entgegengesetzte Erscheinung vor'<br />
also eine Entsprechung von perfektiven Fortnen bei Tieck<br />
nrit inrperfektiven bei Schiller. Darin liegt keinWiderspruch<br />
gegen das obelt Gesagte <strong>und</strong> Gezeigte. Vielntehr deutet<br />
gerade diese Erscheinung attf letzte Wurzeln ttnd Unterscheidungen:<br />
Sch. IV/VII.<br />
T. rv/1il.<br />
Ich kann nicht daran denken, daß das lebte,<br />
Was ntir das Teuerste auf Erden rvar.<br />
Vergessen kann ich nicht, daß das gewesen,<br />
Was mir das Liebste war.<br />
Sch.lV/\tl.<br />
Und sie, die dich gebar,<br />
Weit öfter auf den Knieen als itn Glanz,<br />
Sie starb an jedern Tage, den sie lebte'<br />
Sclt. lViVI. Noch eh du kaurst,<br />
Ist schon der alte Seiward, wohlgerüstct,<br />
Mit einem Heer nach Schottland aufgebrochen.<br />
Der Leser muß hier fühlbarer als sonst, urn die Stelle<br />
zu verstehen, eine innere Umstellung vornehmen. Er mttß<br />
seine Zeitperspektive verwandeln, aus einer Stilsphäre in<br />
die andere treten. Wer nrit romantischetn Sprachklang int<br />
Ohr an die Fassung Schillers herantritt, vermag tiicht<br />
ohne weiteres deren Sinn zu erfassen. Denn er wird die<br />
Form ,,lebte" mit dem Gefüht zeithafter Dauer durchdringen.<br />
Um das Gegenteil aber handelt es sich: ,,lebte" soll<br />
sagen,,aufgehört hat zu leben". Es ist nicht irnperfektisclt,<br />
es ist perfektisch zu fassen. Die Stelle beleuchtet schlaglichtartig<br />
alle übrigen diesbezüglichen Fortnen. Wie kÖnnte<br />
Schiller das Imperfekt plötzlich in so ausgeprägter Weise<br />
perfektisch verwenden, wenn es in seinem Stile nicht<br />
durchweg einen zumin<strong>des</strong>t verwandten Charakter trüge.<br />
Bestätigend treten andere Beispiele hinzu. Nur zwei<br />
nöchte ich herausgreifen:<br />
,,Uul zu verstehen, was ich meine, bedenke rnan, wie<br />
der rnenschliche Geist sich fortwährend in zweierlei Zeitanschauungen<br />
bewegt, in einer prirnären <strong>und</strong> einer sek<strong>und</strong>ären,<br />
einer unmittelbar geschauten <strong>und</strong> einer begrifflich<br />
konstruierten. Die unmittelbare Zeitanschauung ist Sensation,<br />
Empfindung, innerliches Erlebnis, Rhythntus, unteilbare,<br />
konkrete. fortlaufende Dauer. Sie ist der Putsschlag<br />
<strong>des</strong> <strong>Leben</strong>s, in den der Geist sich einfühlt, den er<br />
anschaut, in<strong>des</strong> er sich von ihm tragen läßt. Die mittelbare<br />
Zeitanschauung ist ein abstraktes, räumliches Geschehen,<br />
ist gemessene, geteilte, in die Außenwelt hinaus projizierte<br />
Zeit. Henri Bergson, der den Unterschiedieser<br />
beiden Zeitformen wohl am klarsten herausgearbeitet lrat,<br />
nannte die erste le temps qualit6, oder auch Ia durde r6elle,<br />
die zweite lc temps quantit6, ternps 6tendu, temps spatialise.<br />
(Karl Vossler in ,,Frankreichs Kultur im Spiegel<br />
seiner Sprachentrvicklung")t). In dieser Unterscheidung<br />
liegt auch der Schlüssel für unsere Frage. Die räumlichc<br />
Zeitanschauung Schillers steht gegen die innerliche dcr<br />
Tieck. Aus ruhender Warte betrachtet Schiller messend,<br />
teilend, begrenzend den Lauf der Dinge. Seine Vergangenheit<br />
ist eine abgeschlossene, fertige, als Zeit nicht mehr<br />
lebendige. So nähert sich in seinem stil auch das Imperfektum<br />
perfektivem Charakter. Nicht so in der Romantik:<br />
in ihren Formen wird das Vergangene noch einmal tönend,<br />
werdend, schwingend. Denn der romantische Mensch<br />
schwebt im Flusse der Dinge <strong>und</strong> was einmal gewesen,<br />
quillt noch in ihnr als Traum <strong>und</strong> Erinnerung.<br />
l) Heidelberg 1913, S.314.<br />
G.A. Bürger-Archiv<br />
G.A. Bürger-Archiv


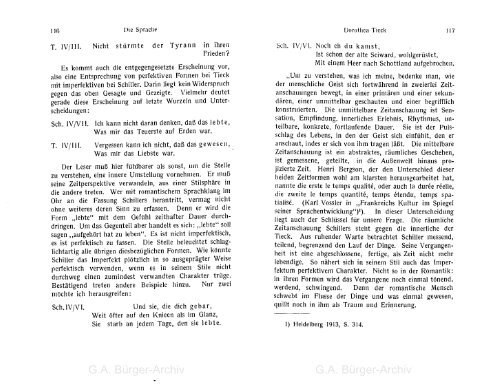

![ERNSTEN BALIADE DIIR(]H G. A. BÃRGnR. - Leben und Werk des ...](https://img.yumpu.com/50237579/1/190x146/ernsten-baliade-diirh-g-a-bargnr-leben-und-werk-des-.jpg?quality=85)











