Hochgesangs Wandlungen des Dichtstils - Leben und Werk des ...
Hochgesangs Wandlungen des Dichtstils - Leben und Werk des ...
Hochgesangs Wandlungen des Dichtstils - Leben und Werk des ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
60<br />
Komposition<br />
Komposition<br />
l8l<br />
sische Dramatik <strong>des</strong> 18. Jahrh<strong>und</strong>erts ersetzt sie durch die<br />
Notwendigkeit der Entfaltung. Was dort Klarheit, Ordnung,<br />
Stetigkeit der starren Anschauung, wird hier Klarheit,<br />
Ordnung, Stetigkeit <strong>des</strong> Verlaufes. Und in diesern Sinne<br />
möchte man abschließend das Gegeneinander von deutscher<br />
<strong>und</strong> italienischer Klassik bestimmen: Der südliche Mensch,<br />
weil er in seinem tiefsten Wesen schon ein klassisch ge'<br />
schlossener <strong>und</strong> in sich ruhender ist, gestaltet eine klassische<br />
Welt in isolierten Erscheinungen <strong>und</strong> setzt die Allgemeingültigkeit<br />
seiner Maße <strong>und</strong> Formen \/oraus. Es gibt<br />
nichts Bezeichnenderes für die italienische ftenaissance,<br />
als daß sie in ihrer Kunst den Menschen zu lvlaß <strong>und</strong> Mitte<br />
alles Seins erhebt, ohne die Maßstäbe der Gotik zerbrochen,<br />
ohne die transzendental gerichtete Gemeinschaft der Kirche<br />
gesprengt zu haben. Der deutsche Mensch aber, weil zutiefst<br />
verschlungen in die Gesamtheit aller Natur <strong>und</strong> alles<br />
Geschehens, muß erst die Welt als Ganzes <strong>und</strong> in all ihren<br />
Dimensionen mit zeitlosen Werten umgrenzen <strong>und</strong> mit<br />
Notwendigkeit <strong>und</strong> Klarheit durchdringen, ehe er sich selbst<br />
als ruhende Form in ihr vollenden kann.<br />
Die italienische Renaissance hatte ihre Auflösung gef<strong>und</strong>en<br />
im Barock, die Klassik <strong>des</strong> 18. Jahrh<strong>und</strong>erts findet<br />
sie in der Romantik. Der Barock enthüllt den inneren<br />
Bruch zwischen der ruhenden Form <strong>und</strong> dem unendlich<br />
vorwärtsstürmenden <strong>Leben</strong>, er enthüllt auch die stofflichen<br />
Züge alles Anschaulichen <strong>und</strong> Körperlichen, damit <strong>des</strong>sen<br />
individuelle Bedingtheit <strong>und</strong> zeitliche Vergänglichkeit. So<br />
erwacht im barocken Menschen die Sehnsucht nach dent<br />
Geiste als dem lmmergültigen <strong>und</strong> Ewigbleibenden, als<br />
dem Gesetzgetragenen <strong>und</strong> Gesetzerhaltenden, <strong>und</strong> langsam<br />
findet er den Weg hinüber zu den selbstsicheren Formen<br />
rationalistischer Weltgesinnung. Die Romantik andererseits<br />
wird durch den unstofflichen <strong>und</strong> ideellen Charakter<br />
klassischer Bitdungswelt <strong>des</strong> 18. Jahrh<strong>und</strong>erts verführt,<br />
an die Geistigkeit alles Daseins <strong>und</strong> an die Scheinhaftigkeit<br />
aller klassischen Anschauung von Gliederung <strong>und</strong><br />
Umgrenzung<br />
glauben. Aus solcher Erkenntnis entquillt<br />
ihr das Verlangen, hinabzutauchen hinter solchen Schein<br />
in die alleine <strong>und</strong> allurnfassende Tiefe. Im letzten Gr<strong>und</strong>e<br />
bedeutet das die Flucht <strong>des</strong> Geistes vor sich selber. Er<br />
möchte seinen eigenen Maßen <strong>und</strong> Ordnungen entrinnen,<br />
er möchte aus seiner Schöpfung, in die er sich verstrickt,<br />
wieder zu sich selber finden. So führt die Romantik<br />
schließlich zur Selbstzersetzung <strong>des</strong> Geistes wie zur Auflösung<br />
seiner Bildungswelt, <strong>und</strong> sie endet dort, wo der<br />
Barock begonnen, mit der Entdeckung einer stoffgetragenen<br />
ungeistigen Realität. Im Schoße der Romantik wohnt der<br />
Materialismus <strong>des</strong> werdenden Jahrh<strong>und</strong>erts.<br />
Als höherer geistiger Organismus wurde Shakespeares<br />
künstlerische Welt von der Romantik neu erfaßt <strong>und</strong> verkündet.<br />
Organischatte schon die Klassik die Welt gesehen<br />
<strong>und</strong> als organische Einheit hat sie auch je<strong>des</strong> Kunstwerk<br />
betrachtet. Aber organischatte für sie noch einen<br />
anderen Sinn. Noch bedeutet es nicht die Negation alles<br />
Mechanischen <strong>und</strong> Gesetzgeb<strong>und</strong>enen um eines unendlich<br />
schöpferisch sich entfaltenden <strong>Leben</strong>s willen. Organisch ist<br />
vielmehr für den klassischen Menschen eben das, was wie<br />
aus freiem Antrieb nach Gesetzen sich entfaltet. Shakespeares<br />
künstlerische Welt konnte vor solchem l\laßstabe<br />
nur immer beschränkte Geltung haben. Sie mußte, um vor<br />
klassischent Auge bestehen zu können, - <strong>und</strong> wir haben<br />
das an dem einen Beispiel von Schillers Macbethbearbeitung<br />
ja bereits gesehen - die verschiedenartigsten Veränderungen<br />
iiber sich ergehen lassen. Solches Recht, Shakespeares<br />
<strong>Werk</strong>e zu entstellen, aber leugnete die Romantik. Sie hatte<br />
erkannt, wie in ihnen alles von einer Mitte beseelt, von<br />
einem Atem durchbebt ist, so daß kein Zug verändert<br />
werden kann, ohne das Ganze zu treffen. Aus solchem<br />
G.A. Bürger-Archiv<br />
G.A. Bürger-Archiv


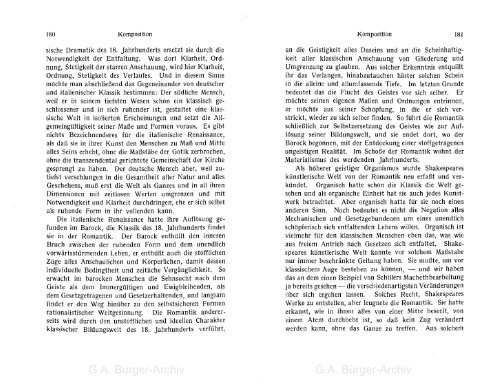

![ERNSTEN BALIADE DIIR(]H G. A. BÃRGnR. - Leben und Werk des ...](https://img.yumpu.com/50237579/1/190x146/ernsten-baliade-diirh-g-a-bargnr-leben-und-werk-des-.jpg?quality=85)











