Hochgesangs Wandlungen des Dichtstils - Leben und Werk des ...
Hochgesangs Wandlungen des Dichtstils - Leben und Werk des ...
Hochgesangs Wandlungen des Dichtstils - Leben und Werk des ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Rhythrnus<br />
r35<br />
Rhythmus.<br />
Das ist das Dunkle, das Dämonische, das Ungeheuere in<br />
,,Macbeth", erst der Kampf gegen den Rhythrnus gestaltet<br />
den Rhythmus. Macbeth lehnt sich nrit jeder neuen Tat auf<br />
gegen den Gang der Welt - er will sich setzen, sich bervahren<br />
-" <strong>und</strong> führt doch mit jeder neuen Tat diesen<br />
schicksalsgezeichneten Rhythmus, der seine Vernichtung<br />
einschließt, der Vollendung näher.<br />
Man nrag errnessen, was die rhythmische Form für das<br />
Drama Shakespeares bedeuten muß. Ein Herauslösen <strong>des</strong><br />
nur Inhaltlichen ist eine Unmöglichkeit, denn der Stoff lebt<br />
erst durch seine Form, lvie die Form erst durch de:r Stoff.<br />
Eine prosaische übersetzung bricht der Handlung die<br />
Seele aus: den vorjagenden Atem, die zukunftschwangere<br />
Gegcnwärtigkeit. Tlotzden bedeutet die prosaische Bearbeitung<br />
Shakespeares durch Wieland-Eschenburg auch in<br />
formaler Hinsicht einen Fortschritt, wenn man sie in Vergleich<br />
setzt zu denl, was früher in dieser Hinsicht geleistet<br />
worden ist. Denn Shakespeare die rhythmische Seele zu<br />
rauben <strong>und</strong> ihn in eine abstrakte <strong>und</strong> vernünftige prosa zu<br />
füllen, ist noch nicht die unterste der denkbaren Entstellungen.<br />
Es gibt noch ein weiteres. Für den rationalistischen<br />
Menschen war Poesie eine Belustigung <strong>des</strong> Verstan<strong>des</strong><br />
<strong>und</strong> Witzes, <strong>und</strong> damit auch Shakespeare dem genügen<br />
konnte, nrußte man ihn in tändelnde <strong>und</strong> gereimte<br />
Verse bringen. Borck hatte sich 1740 dieser Arbeit unterzogen,<br />
zwar nicht an ,,Macbeth',, wohl aber an ,,Julius<br />
Cäsar". (Die entwicklungsgeschichtliche Bedeutung dieser<br />
Übersetzung soll damit nicht bestritten werden.) tctr<br />
nröchte einige Zeilen daraus hierher setzen, weil erst dieser<br />
Alexandriner-shakespeare eine vollc Vorstellung rationalistisch-klassizistischer<br />
Kunstauffassung gibt. Aus der<br />
Volksszene <strong>des</strong> dritten Aktesr):<br />
Anton: Wollt ihr Geduld mit mir noch eiue Weile tragen,<br />
Ich übereilte mich vorn Testament zu sagen.<br />
Ich fürchte, daß dadurch den Männern Leid geschicht,<br />
Den braven Lcutcn dort, die Cäsarn hirtgericht.<br />
Gegcniiber dieser Art von Rhythmik bedeutet Eschenburgs<br />
Prosa einen entschiedenen Fortschritt, indem sie den<br />
Weg frei rnacht zu neuen, Shakespeare näherkommenden<br />
rhythmischen Bearbeitungen. Eschenburg hat, die Unhaltbarkeit<br />
solcher Forntung Borcks erkeunend, diesen scharf<br />
kritisiert2). Andrerseits ernpfand er auch, dafj die rhythrnische<br />
Form Shakespeares für das Drama uud seineu Gehalt<br />
niclrt gleichgüliig ist. ,,Ein beträclttlicher Verlust für dcnjenigen,<br />
der den Shakespeare nur deutsch lesen kann, ist<br />
der Abgang <strong>des</strong> Silbennraßes3)". Aber was trotz solcher<br />
theoretischen Einsicht eine wirklichc Nachbildung <strong>des</strong><br />
Shakespeareschen Rhythmus bei Eschenburg ausschließt,<br />
das ist das mangelnde rhythnrisctte Gefühl, das fehlende<br />
Erlebnis der Welt als Zeit <strong>und</strong> Bewegung. Was Eschenburg<br />
am Verse schätzt, das ist nichts eigcntlich Rhythmisches. sctttclern<br />
,,Feierlichkeit <strong>und</strong> Würde". ,,Man weiß, dalS der Gang<br />
<strong>des</strong> Verses, selbst der dialogische Gang <strong>des</strong>selben, vor dettt<br />
Gange der Prose, selbst der edleren, allemal etne Feierlichkeit<br />
<strong>und</strong> Würde voraus hat, die manchen Ausdrücken <strong>und</strong><br />
l\ Zitiert nach R. Gen6e, Geschichte <strong>des</strong> Shakespeareschen<br />
Dramas in Deutschland. Leipzig 1870, S. 433.<br />
2) H. Schrader: Eschenbrtrg <strong>und</strong> Shakespeare. Diss. Marburg<br />
1911, S. 59.<br />
3) Vorbericht z. I. Band der ersten Ausgabe.<br />
G.A. Bürger-Archiv<br />
G.A. Bürger-Archiv


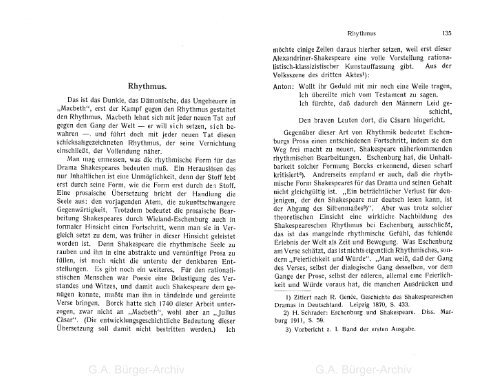

![ERNSTEN BALIADE DIIR(]H G. A. BÃRGnR. - Leben und Werk des ...](https://img.yumpu.com/50237579/1/190x146/ernsten-baliade-diirh-g-a-bargnr-leben-und-werk-des-.jpg?quality=85)











