Hochgesangs Wandlungen des Dichtstils - Leben und Werk des ...
Hochgesangs Wandlungen des Dichtstils - Leben und Werk des ...
Hochgesangs Wandlungen des Dichtstils - Leben und Werk des ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
I/tl<br />
I{omposition<br />
lvird, lvas dem Macbeth gleich mit dern Eingang der Handlung<br />
den Charakter <strong>des</strong> Guten, <strong>des</strong> edlen Helden gibtr).<br />
Damit wird notwendig das Interesse ant Geschehen nach<br />
der Seite <strong>des</strong> Moralischen hin umgebogen. Das polare<br />
Gegeneinandertreten von Macbeth <strong>und</strong> seiner Lady schafft<br />
bei Schiller der Handlung auch im Gegenständlichen jene<br />
statuarische <strong>und</strong> in sich selbst {efestigte Haltung, wie sie<br />
klassischer Art entsprechend istz).<br />
Shakespeares Macbeth bedeutet eine letzte übersteigerung<br />
dynamischer Weltgestaltung. Es müßte uns daher<br />
w<strong>und</strong>erbar erscheinen, da13 gerade dieses Stück Schiller<br />
in Bearbeitun genommen hat, würde uns nicht ein<br />
anderer Unrstand erläuternd zu Hilfe kommen: In keinem<br />
zweiten seiner <strong>Werk</strong>e ist Shakespeare in seiner Forrngebung<br />
so knapp. so übersichtlich, so einheitlich geschlossen wie<br />
hier. Freilich, für Shakespeare war diese Einheiilichkeii<br />
<strong>und</strong> übersichtliche Gedränstheit Ausdruck höchster dvnamischer<br />
Über,türzung, fUr öchiller aber - so berühren sich<br />
die Extreme - mochte eben darin der Ausgangspunkt<br />
liegen, in das irrationale schöpferische Werden <strong>und</strong> Geschehen<br />
eine gesetzhaft-geb<strong>und</strong>ene klassische Haltung<br />
hineinzulesen. In<strong>des</strong>sen auch noch ein anderer Umstand<br />
war imstande, verknüpfende Brücken zu schlagen zwischen<br />
Shakespeares Barock <strong>und</strong> Schillers klassischer Formgebung:<br />
Ich meine das Schicksalsmotiv, das ja in Macbeth eine bedeutsame<br />
Rolle spielt. Schiller nimmt Shakespeares Hexen,<br />
die Verkünderinnen <strong>des</strong> Schicksalsspruches, aus der düsteren<br />
Atmosphäre <strong>des</strong> Stückes, in die sie bei Shakespeare<br />
eingebettet sind, heraus, er beraubt sie ihres Zwitterqlg4lrt,t:lhrer<br />
zwischen Wirklichkeit <strong>und</strong> Traum schwel)<br />
Darauf, daß Schiller diese Auffassung durch mehrmalige<br />
Verleihung <strong>des</strong> Prädikats ,,edel" an Macbeth zu stützen unter.<br />
nirnmt, sei ergänzend hingewiesen.<br />
2) Vgl. Fritz Strich, Deutsche Klassik <strong>und</strong> Romantik, S. 192.<br />
I(omposition 177<br />
benden Umrisse <strong>und</strong> macht sie in festen Konturen (sie<br />
empfangen die lichte Klarheit griechischer Sagengestalten)<br />
zur zeitlosen Umrandung <strong>des</strong> dramatischen Verlaufes.<br />
Damit tritt auch der Schicksalsspruch aus dem Doppellicht<br />
subjektiver <strong>und</strong> objektiver Bedeutsamkeit in die durch_<br />
sichtige Helle symbolischer Formen nach klassischer Ge_<br />
staltungsart. Er empfängt die Aufgabe, dem Handlungsverlauf<br />
die tektonische Festigkeit <strong>und</strong> unverrückbare Not_<br />
wendigkeit einer analytischen Entfaltung zu geben, wie sie<br />
dem klassischen Drama in stärkerem oder geringerem Grade<br />
immer eigen ist. Wenn Schiller dabei die sitiliche Freiheit<br />
<strong>des</strong> Menschen solchenr Schicksalslauf gegenüber in eigenen<br />
Zusätzen ausdrücklich betont, so liegt das ganz in der<br />
Richtung seiner in Kants Bahnen sich bewegenden weltanschaulichen<br />
Vorstellungen. Diese Zusätze retten dem<br />
Canzen das sittliche Interesse, bezwecken aber keineswegs<br />
die formende <strong>und</strong> gesetzhaft ordnende Kraft jener klassischen<br />
Schicksalssymboltk zu erschüttern.<br />
Daß alle diese Umstellungen <strong>und</strong> Umgestaltungen, die<br />
wir bisher an Schillers Ä{acbeth zu beobachten hatten,<br />
letzten En<strong>des</strong> auch eine Umgestaltung der Handlung ' in<br />
ihrem innersten Gehalte bedeuten müssen, wie sie aus<br />
solcher verschiedenen Auffassung dieses Gehaltes heraus<br />
überhaupt erst denkbar sind, ist selbstverständlich <strong>und</strong><br />
hier <strong>und</strong> dort bereits deutlich geworden. ,,Macbeth ist..<br />
bei Schiller, ,,wie Wallenstein, wie Polykrates' zu glücklich<br />
<strong>und</strong> vertraut seine Wurde zu sehr dem Glücke an"' So<br />
verfällt er der Versrrchung der Hexen, die-als Botinnen <strong>des</strong><br />
Schicksals erscheinen, uri i'it irdische.s Clück Entgeltung<br />
zu fordern. ,,Was bei Shakespeare die dämonische Notwendigkeit<br />
der Natur zu wirken scheint' das wirkt bei<br />
Schiller die sitfliche Notwendigkeit<br />
der Nemesis"l)'<br />
-D<br />
Vgl. Fr. Strich, Schiller' sein <strong>Leben</strong> <strong>und</strong> sein <strong>Werk</strong>'<br />
Leipzig 1912, S. 370.<br />
Hochgesang, wandlungen <strong>des</strong> <strong>Dichtstils</strong>' 12<br />
G.A. Bürger-Archiv<br />
G.A. Bürger-Archiv


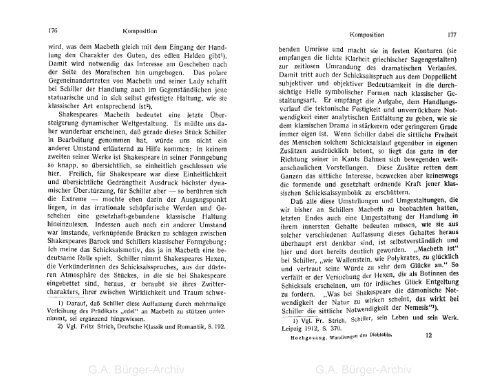

![ERNSTEN BALIADE DIIR(]H G. A. BÃRGnR. - Leben und Werk des ...](https://img.yumpu.com/50237579/1/190x146/ernsten-baliade-diirh-g-a-bargnr-leben-und-werk-des-.jpg?quality=85)











