Hochgesangs Wandlungen des Dichtstils - Leben und Werk des ...
Hochgesangs Wandlungen des Dichtstils - Leben und Werk des ...
Hochgesangs Wandlungen des Dichtstils - Leben und Werk des ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
172 Komposition<br />
I(omposition<br />
r73<br />
Umgebungen <strong>des</strong> Tyrannen ausdrücklich in Kontrast gesetzt<br />
sind, geben durch ihre Erscheinungen von dem Zustande<br />
<strong>des</strong> Reiches ein ganz anderes <strong>und</strong> lebendigeres Bild,<br />
<strong>und</strong> ihr Übertritt wirft auch auf Macbeth ein ganz anderes<br />
Licht zurück, als der von zwei anderen, die schon ihrer<br />
Lage wegen nicht umhin können, eine von den beiden Parteien<br />
sogleich zu ergreifen"l). Von ganz besonderer Bedeutung<br />
für die klassische Eigenart von Schillers Übersetzung<br />
ist sodann die Neuordnung <strong>des</strong> gesamten Hand-<br />
!ungsverlaufes. Statt der tiefenhaften irrationalen Verwandlungen<br />
Shakespeares erstrebt Schiller überall eine<br />
übersichtliche <strong>und</strong> stetige Linienführung. So werden schon<br />
im Akt I durch Schiller Szene I <strong>und</strong> II ohne Schauplatzwechsel<br />
ntiteinander verknüpft, ebenso Szene V, VI, VIl.<br />
In Akt II wird in der Bearbeitung überhaupt jeder Szenenwechsel<br />
vermieden. Wenn Schiller dabei als Schauplatz für<br />
diesen Akt ein Zimmer statt <strong>des</strong> Schloßhofes vorschreibt,<br />
der bei Shakespeare hauptsächlich in Betracht steht, so<br />
liegt auch das in der Richtung einer Entstofflichung, Verflachung<br />
<strong>und</strong> Idealisierung aller räumlichen Tiefe. Die<br />
Bedeutung von Szene IV dieses Aktes in Shakespeares<br />
Fassung habe ich bereits bei Bürger besprochen: Sie öffnet<br />
die Perspektive <strong>und</strong> läßt die Geschehnisse <strong>des</strong> Vordergrun<strong>des</strong><br />
hinausverfolgen<br />
die Breite der Welt. Indem<br />
Schiller diesen Auftritt ohne Szenenwechsel an den<br />
vorausgehenden anschließt, tilgt er seinen Hintergr<strong>und</strong>scharakter<br />
<strong>und</strong> rückt ihn auf eine gemeinsame Fläche<br />
mit der übrigen Handlung. In Akt III hat Schiller<br />
die Vermeidung eines Schauplatzwechsels zwischen Szene II<br />
<strong>und</strong> III durch Streichung bedeutsamer Worte der Lady<br />
.lkrrffl. Die beiden letzten Szenen dieses Aktes, Szene V<br />
1) Aus Schleiermachers <strong>Leben</strong>. ln Briefen. Herausgegeben<br />
von W. Dilthey. Berlin 1863, IV, S. 542.<br />
2) Ygl. darüber A. Köster, Schiller als Dramaturg, S. 103.<br />
<strong>und</strong> VI, werden durch Schiller aus demselben irerausgenommen<br />
<strong>und</strong> in umgekehrter Folge an den Beginn<br />
<strong>des</strong> IV. Aktes gestellt. Auf solche Weise vermag Schiller<br />
die Hekateszene <strong>des</strong> I I I. Aktes mit den Hexenszenen<br />
<strong>des</strong> IV. Aktes zu einer Szene zu verschmelzen, so daß<br />
nun nicht mehr im IV. Akte sich Hekate <strong>und</strong><br />
ihre Hexen nach einer schon in der vorletzten Szene<br />
<strong>des</strong> III. Aktes gemachten Übereinkunft zusammen finden.<br />
Man sieht: Schiller vermeidet durch diese Umstellung<br />
die ineinandergreifende Form von Shakespeares<br />
barockem Stil zugunsten einer Gliederung <strong>des</strong> dramatischen<br />
Aufbaus in klar in sich geschlossene Aktel). Die<br />
Ermordungsszene der Lady Macduff von Shakespeares<br />
IV. Akt ist bei Schiller ausgeblieben. Die Anderungen<br />
Schillers im V. Akt bringen mit der Einschränkung der Verwandlungen<br />
auch die Ausschaltung <strong>des</strong> immer neuen<br />
Wechsels von Hintergr<strong>und</strong> <strong>und</strong> Vordergr<strong>und</strong>, der für das<br />
Original charakteristisch ist. In<strong>des</strong>sen geht Schiller nichi<br />
so weit wie Bürger, der Shakespeares Szenen II <strong>und</strong> IV<br />
überhaupt verschwinden ließ. Schiller zieht diese beiden<br />
Szenen zu einer einzigen zusammen <strong>und</strong> läf3t diese neue<br />
Szene gleich nach der Einleitungsszene der nachtwandelnden<br />
Lady folgen. Dadurch gestaltet er den Gang der<br />
Handlung stetiger, ohne, wie Bürger, die anschauliche Gestaltungsart<br />
Shakespeares gänzlich zu vernichten.<br />
,,Die Wendung der Tragödie nach der Komik hin gibt<br />
dem barocken Drama <strong>und</strong> dem Drama der Romantik<br />
Tiefe"2). Wenn Schiller die komischen Züge, welche Shakel)<br />
Vgl. Fritz Strich, Deutsche Klassik <strong>und</strong> Romantik, S. l8l:<br />
,,schitler hat in seiner Übersetzung <strong>des</strong> Macbeth durch eine<br />
scheinbar wesenlose Umstellung zweier Szetten die ineinandergreifende<br />
<strong>und</strong> eine Form <strong>des</strong> barocken Stils zugunsten einer<br />
klaren Gliederung in geschlossene Akte ganz zerstört.<br />
2) Ebenda, S. 180.<br />
G.A. Bürger-Archiv<br />
G.A. Bürger-Archiv


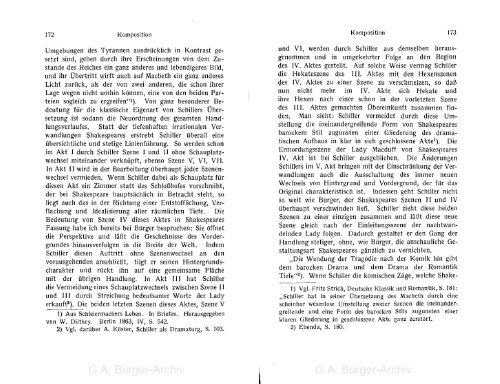

![ERNSTEN BALIADE DIIR(]H G. A. BÃRGnR. - Leben und Werk des ...](https://img.yumpu.com/50237579/1/190x146/ernsten-baliade-diirh-g-a-bargnr-leben-und-werk-des-.jpg?quality=85)











