- Seite 1:
m VA^,i^y
- Seite 8 und 9:
ìa.9c\sr'\iV- STEPHANEUM NYOMDA R.
- Seite 10 und 11:
2 TARTALOM Irodalmi ismertetések.
- Seite 12 und 13:
4 INHALT Literaturbeprechungen. Cha
- Seite 14 und 15:
6 SCHENK JAKAB a háború után s h
- Seite 16 und 17:
SCHENK JAKAB
- Seite 18 und 19:
10 JAKOB SCHENK den Reihen unserer
- Seite 20 und 21:
12 JAKOB SCHENK durch die Darstellu
- Seite 22 und 23:
14 SLHENK JAKAB Bogár Venczel pr.
- Seite 24 und 25:
16 SCHENK JAKAB Ujváry Irma pr. m.
- Seite 26 und 27:
18 SCHENK JAKAB ^ 61 Bácsszentivá
- Seite 28 und 29:
20 SCHENK JAKAB 83 Oörgényüvegcs
- Seite 30 und 31:
22 SCHENK JAKAB SO Felskabol, 71 Re
- Seite 32 und 33:
24 SCHENK JAKAB 61 Patosfa, 73 Szab
- Seite 34 und 35:
26 SCHENK JAKAB 70 Rózsahegy, 91 L
- Seite 36 und 37:
28 SCHENK JAKAB Ó8. ^^-K Circus cy
- Seite 38 und 39:
30 SCHENK JAKAB 97 Kolozsvár, 98 T
- Seite 40 und 41:
32 SCHENK JAKAB ucsa, 99 Felsvist,
- Seite 42 und 43:
34 SCHENK JAKAB rozsnyó, 97 Földv
- Seite 44 und 45:
36 SCHENK JAKAB 100 Székelyzsombor
- Seite 46 und 47:
38 SCHENK JAKAB Vtxits, 104 Kismart
- Seite 48 und 49:
40 SCHENK JAKAB háza, 5Q Bellye, 6
- Seite 50 und 51:
42 SCHENK JAKAB gyertyános, 61 Ny
- Seite 52 und 53:
44 SCHENK JAKAB 69 Földvár, 66 T
- Seite 54 und 55:
46 SCHENK JAKAB 73 Budapest, 72 Ny
- Seite 56 und 57:
48 SCHENK JAKAB 9. Turtur turtur (L
- Seite 58 und 59:
50 SCHENK JAKAB
- Seite 60 und 61:
52 SCHENK JAKAB •ii
- Seite 62 und 63:
54 SCHENK JAKAB ìi
- Seite 64 und 65:
56 SCHENK J. A MADÁRVONULÁS M AG
- Seite 66 und 67:
58 HEGYFOKY KABOS III. Febr. Mart.
- Seite 68 und 69:
60 HEOYFOKY KABOS C) Ä hmérsékle
- Seite 70 und 71:
62 JAKOB MEGYFOKY Geben uns die Wet
- Seite 72 und 73:
64 HEGYFOKY KABOS
- Seite 74 und 75:
66 HEGYFOKV KABOS //. A megérkezé
- Seite 76 und 77:
68 JAKOB HEGYFOKY : VOGELZUG UND WE
- Seite 78 und 79:
70 GRESCHIK JEN különösen a nyak
- Seite 80 und 81:
72 GRESCHIK JEN nyálkaréteg mély
- Seite 82 und 83:
74 GRESCHIK JEN Technika. A decapit
- Seite 84 und 85:
76 ORESCHIK JEN fenn. Én azt hisze
- Seite 86 und 87:
73 GRESCHIK JEN tollak sima izomzat
- Seite 88 und 89:
GRESCHIK JEN mint pl. a háton, itt
- Seite 90 und 91:
82 GRESCHIK JEN kötszöveti rost,
- Seite 92 und 93:
84 GRESCHIK JEN vést találtam. A
- Seite 94 und 95:
86 GRESCHIK JEN befejezése után,
- Seite 96 und 97:
88 GRESCHIK JEN Az irha alapállom
- Seite 98 und 99:
90 EUGEN GRESCHIK Stückchen ab. Di
- Seite 100 und 101:
92 EUGEN GRESCHIK Nach Taschenberg
- Seite 102 und 103:
94 EUGEN GRESCHIK Vergleiche flügg
- Seite 104 und 105:
96 EUGEN GRESCHIK Maurer ein Stratu
- Seite 106 und 107:
98 EUGEN GRESCHIK das Corium eine u
- Seite 108 und 109:
100 EUGEN GRESCHIK aus ziemlicli fe
- Seite 110 und 111:
102 EUGEN GRESCHIK sprechend. Glatt
- Seite 112 und 113:
104 EUGEN GRESCHIK Brust (Abb. 7, S
- Seite 114 und 115:
106 EUGEN GRESCHIK elastischen Fase
- Seite 116 und 117:
108 EUGEN GRESCHIK dem fügen sich
- Seite 118 und 119:
110 EUGEN GRESCHIK Maurer, Fr., Gru
- Seite 120 und 121:
112 GRESCHIK JEN ) Iosa) és a tara
- Seite 122 und 123:
[14 GRESCHIK JEN A megvizsgált faj
- Seite 124 und 125:
116 GRESCHIK JEN a MALPiGHi-féle t
- Seite 126 und 127:
118 GRESCHIK JEN megtaláltam. Alak
- Seite 128 und 129:
120 GRESCHIK JEN belül a praecapil
- Seite 130 und 131:
122 GRESCHIK JEN támasztásán kí
- Seite 132 und 133:
124 GRESCHIK JEN'O mely az artéri
- Seite 134 und 135: 126 GRESCHIK JENÍJ különös súl
- Seite 136 und 137: 128 GRESCHIK JEN A burok és a pare
- Seite 138 und 139: 130 GRESCHIK JEN vannak. A burok ha
- Seite 140 und 141: 132 GRESCHIK JEN A burok hálószem
- Seite 142 und 143: 134 EUGEN GRESCHIK noch gut weg. Ih
- Seite 144 und 145: 136 EUGEN GRESCHIK Azokarmini oder
- Seite 146 und 147: 138 EUGEN GRESCHIK wir die sogenann
- Seite 148 und 149: 140 EUGEN GRESCHIK Wasserhuhn dunkl
- Seite 150 und 151: 142 EUGEN GRESCHIK In der Milz eine
- Seite 152 und 153: 144 EUGEN GRESCHIK Dies hängt mit
- Seite 154 und 155: 146 EUGEN GRESCFIIK Netzwerk mit Ke
- Seite 156 und 157: 148 EUGEN GRESCHIK Parenchymgewebe,
- Seite 158 und 159: 150 EUGEN GRESCHIK genen Fasern im
- Seite 160 und 161: 152 EUGEN GRESCHIK etwas stärkeren
- Seite 162 und 163: 154 EUGEN GRESCHIK Im Pulpagewebe s
- Seite 164 und 165: 156 EUGEN GRESCHIK Arterie zu betra
- Seite 166 und 167: 158 EUGEN GRESCHIK Pinto, C, Sullo
- Seite 169 und 170: ÜBER DEN BAU DER MILZ EINIGER VOGE
- Seite 171 und 172: AZ ELS MAGYAR PRAEGLACIALIS MADARFA
- Seite 173 und 174: AZ ELS MAGYAR PRAEGLACIALIS íMADÁ
- Seite 175 und 176: AZ ELS MAGYAR PRAFXiLACIALIS MADARF
- Seite 177 und 178: AZ ELS MAGYAR PRAEGLACIALIS MADÁRF
- Seite 179 und 180: DIE ERSTE UNOARISCHE PRÄOLACIALE V
- Seite 181 und 182: DIE ERSTE UNGARISCHE PRAGLACIALE VO
- Seite 183: DIE ERSTE UNGARISCHE PRAOLACIALE VO
- Seite 187 und 188: £ o N 2 o Aquila. 12
- Seite 189 und 190: FOSSILIS KAG^• FÜLESBAGOLY ÉS L
- Seite 191 und 192: FOSSILIS NAGY FÜLESBAGOLY ÉS EGY
- Seite 193 und 194: FOSSILIS NAGY FÜIHSBAGOIY KS EGYKB
- Seite 195 und 196: úgy, FOSSILIS NAGY FÜLESBAGOLY É
- Seite 197 und 198: FOSSII.IS NAGY FUI ESBAGOLY ÉS EGY
- Seite 199 und 200: FOSSILER UHU UND ANDERE VOOEI.RESTE
- Seite 201 und 202: FOSSILKR UHU UND ANDERE VOGEI RESTE
- Seite 203 und 204: FOSSII.FÍR UHU UND ANDERE VOGELRES
- Seite 205 und 206: ' Ferenczi, FOSSIl.KR UHU UND ANDE
- Seite 207 und 208: =^ Mmâ A héja — Astur palumbari
- Seite 209 und 210: . 1910 A HÉJA ES KARVAL^• TAPI A
- Seite 211 und 212: A HÉJA ES KARVAIV TAPl.Al.EKAROI.
- Seite 213 und 214: A HÉJA HS KAF^VAIA' TÁIM ÁIJ'KÁ
- Seite 215 und 216: A HÉJA ES KARVALY TAPI.AI KKAROI.
- Seite 217 und 218: 10 Görgényszentimre ... A HÉJA K
- Seite 219 und 220: 71 Bácsér A HÉJA ES KARVALY TÁP
- Seite 221 und 222: A HÉJA ES KARVA.'V TAPLAI.KKAROI 2
- Seite 223 und 224: A HFJA ÉS KAínAl.V TÁPLÁI.HKÁR
- Seite 225 und 226: Untersuchungen A H HJA hS KARVALY T
- Seite 227 und 228: UBF.R dip: NAHRUNG DFS HABICHTS UND
- Seite 229 und 230: A Magyar Királyi Ornithologiai Kö
- Seite 231 und 232: A MAGY. KIR. ORNITHOLOGIAI KÖZPONT
- Seite 233 und 234: A MAGY. KIR. ORNITHOLOGIAI KÖZPONT
- Seite 235 und 236:
A MAGY. KIR. ORNITHOLOGIAI KÖZPONT
- Seite 237 und 238:
A MAGY. KIR. ORNITHOLOQIAl KÖZPONT
- Seite 239 und 240:
A MAGY. KIR. ORNITHOLOGIAI KÖZPONT
- Seite 241 und 242:
A MAGY. KIR. ORNITHOLOGIAI KÖZPONT
- Seite 243 und 244:
A MAGY. KIR. ORMTHOLOQIAI Kr)7PONT
- Seite 245 und 246:
A MAGV. KIR. ORNITHOLOGIAI KÖZPONT
- Seite 247 und 248:
A MAGY. KIR. ORN'ITHOLOOIAI KÖZPON
- Seite 249 und 250:
A MAGY. KIR. ORNITI iOLOGlAI KÖZPO
- Seite 251 und 252:
A MAGY. KIR. ORNITHOLOGIAI KÖZFONT
- Seite 253 und 254:
A M AGY. KIR. ORNITHOLOQIAI KÖZPON
- Seite 255 und 256:
A MAGY. KIR. ()Iv'NlTH( )L()(ilAl K
- Seite 257 und 258:
A MAGY. KIR. ORNITHOLOGIAI KÖZPONT
- Seite 259 und 260:
A MAGY. KIR. ORNITHOI.OC.IAI KÖZPO
- Seite 261 und 262:
A MAOY. KIR. ORNITHOLOGIAI KÖZPONT
- Seite 263 und 264:
A MAGY. KIR. ORNITHOLOGIAl KÖZPONT
- Seite 265 und 266:
A MAGY. KIR. ORNITHOLOGIAI KÖZPONT
- Seite 267 und 268:
A MAGY. KIFÍ. ORNI THOLOC.IAI KÖZ
- Seite 269 und 270:
A MAGY. KIÍ^. ORMTHOLOGIAI KÖZPON
- Seite 271 und 272:
A MAGY. KIR. ORMTHOLOGIAI KÖZPONT
- Seite 273 und 274:
A MAGY. KIR. ORNITHOLOGIAI KÖZPONT
- Seite 275 und 276:
A MAGY. KIR. ORNITHOLOOIAI KÖZPONT
- Seite 277 und 278:
A MAGY. KIR. ORNITHOLOGIAI KÖZPONT
- Seite 279 und 280:
A MAGY. KIR. ORNITHOLOÛIAI KÖZPON
- Seite 281 und 282:
DIE VOGELMAF^KIERUNGEN DER KON. UNO
- Seite 283 und 284:
dip: vooelmarkikrungen der kon. uno
- Seite 285 und 286:
DIE VOGELMARKIERUNGEN DER KON. UNO.
- Seite 287 und 288:
DIE VOGEI MARKIERUNGEN DER KÖN. UN
- Seite 289 und 290:
DIE VOGíil.MARKIF.RUNOEN DER KON.
- Seite 291 und 292:
DIF, VO(ìf;i MARKIERUNGEN DER KON.
- Seite 293 und 294:
57 DIE VOGRl.MARKIERUKGEN DVU KÖN.
- Seite 295 und 296:
Difi VOGFI.MARKIF.RUNOKN DHFv^ KON.
- Seite 297 und 298:
DIE VOGHI.MARKIERUNOEN DFiR KON. UN
- Seite 299 und 300:
No. 5562. DIE VOGEl.MARKIERUNGEN DE
- Seite 301 und 302:
DIE VOGELMARKIKRUNCjEN DER KON. UN(
- Seite 303 und 304:
Skutari in DIE VOGELMAÍÍKIERUNOEN
- Seite 305 und 306:
DIE VOOKI.WARKIHRUNíHiN DKR KON. U
- Seite 307 und 308:
DIE VOGEI.MARKIErWNCjEN DER KON. UN
- Seite 309 und 310:
DIF. VOGEI MARKIKRÜNOKX DER KON. U
- Seite 311 und 312:
DIE VOriF.I.MARKIhRUNGEN DHU KON. U
- Seite 313 und 314:
DIE VOGfíI..\\ARKIHRUNGEN DhR KON.
- Seite 315 und 316:
DIE VOGELMARKIIiRUNGKN DER KON. UNO
- Seite 317 und 318:
DIE VOGELMARKIERUNGEN DER KON. UNG.
- Seite 319 und 320:
DIE VOGEL iMARKIEf^UN(if:N DER KON.
- Seite 321 und 322:
dip; VOGFJ.MARKIKRUNGEN DKR kon. UN
- Seite 323 und 324:
DIE VOGKI MARKIKRUNGHN DtR KON. UNO
- Seite 325 und 326:
DIE VOíiELMARKIhí^UNOEN DER KON.
- Seite 327 und 328:
DIE VOGELMARK1F.RUNOF.N DER KÖN. U
- Seite 329 und 330:
DIE VOGELMARKIERUNGhN DER KON. UNG.
- Seite 331 und 332:
DIE VOGELMARKIERUNÜEN DER KON. UNO
- Seite 333 und 334:
DIE VOGELMARKIKRUNOEN DER KON. UNO.
- Seite 335 und 336:
dip: VOOKIMARKIERUNQKN DF,R KON. UN
- Seite 337 und 338:
Dlf: VOGELMARKIERUNGKN Dtí? KÖN.
- Seite 339 und 340:
Adatok Szerbia madárfaunájához.
- Seite 341 und 342:
Dodatak ADATOK SZERBIA MADARFAUNAJA
- Seite 343 und 344:
MATERIAI.IfíN /UR AVIFAUNA SERBIEN
- Seite 345 und 346:
MATfiíílAI.IfíN ZUR AVIFAUNA SER
- Seite 347 und 348:
ADATOK SZKRBIA MADARFAUNÁJÁIIO/ 3
- Seite 349 und 350:
ADATOK SZERBIA MADÁRFAUNÁJÁHOZ 3
- Seite 351 und 352:
ADATOK SZHRBIA MADÁRFAUNÁJÁHO/ 3
- Seite 353 und 354:
ADATOK SZERBIA MADÁRFAUNÁJÁHOZ 3
- Seite 355 und 356:
ADATOK SZERBIA MADARFAUNAJAHOZ 345
- Seite 357 und 358:
ADATOK SZERBIA MADARFAUNAJAHOZ 347
- Seite 359 und 360:
gyjtött. ADATOK SZERBIA MADARFAUNA
- Seite 361 und 362:
ADATOK SZKRBIA iMADARFAUNAJAHOZ 351
- Seite 363 und 364:
PETÉNYI J. SALAMON I EVEI. EI 353
- Seite 365 und 366:
J. SALAMON V. PF-:ThN\IS BF^IKFF 35
- Seite 367 und 368:
J. SALAMON V. PKTKNVIS FiRIKFE 357
- Seite 369 und 370:
J. SALAMON V. PF.TENVIS BRIhFf-: 35
- Seite 371 und 372:
J. SAIAMON V. PF.TF.NYIS BRIhFíí
- Seite 373 und 374:
J. SALAMON V. PETÉNYIS BRIEFE 363
- Seite 375 und 376:
J. SALAMON V. p^:T^;^^lS brihfp: 36
- Seite 377 und 378:
J. SALAMON V. PKTEWIS ERU.PF. 367 a
- Seite 379 und 380:
J. SALAMON V. PKTLNVIS HRIHFF. 369
- Seite 381 und 382:
I.^'DhKK^-:R richard 371 lángelmé
- Seite 383 und 384:
RICHARD LVDKKKER 373 idealistisches
- Seite 385 und 386:
RICHARD LYDEKKER 375 Leben war eine
- Seite 387 und 388:
RICHARD LYDEKKKR 377 — A Geograph
- Seite 389 und 390:
IRODALMI ISMERTETÉSEK 379 Kuklensk
- Seite 391 und 392:
IRODALMI IS.WKRThTKShK 381 Subordo
- Seite 393 und 394:
IRODALMI IS.\\KríTP;Tf-:SP:K 383 t
- Seite 395 und 396:
IRODALMI ISMF.RTETESHK 385 Ehelyett
- Seite 397 und 398:
IRODALMI ISMF.RTF.TKSEK 387 tes pha
- Seite 399 und 400:
l.lTERATURBESPRtCHUNGEN 389 Literat
- Seite 401 und 402:
LITF.RATURBKSPRF.CHUNGhN 391 wahrsc
- Seite 403 und 404:
LIThRATURBFSPRKCHUNGfìN 393 Nannop
- Seite 405 und 406:
I.ITERATL'RBESPRF.CHUNTxKN 3Q3 bei
- Seite 407 und 408:
LITRRATURBESPRKCHUNGEN 3y7 eine Rei
- Seite 409 und 410:
I.ITERAïURMhSPRhCHUNOF.N 399 Aus d
- Seite 411 und 412:
Kisebb közlemények. — Kleinere
- Seite 413 und 414:
KISf-KFi KOZLEMhNVHK 403 Lhassa-Tib
- Seite 415 und 416:
KLEINKRK MITTHILUNOfN 4O5 war als b
- Seite 417 und 418:
KLEINERE MITThll.UNGEN 407 fringill
- Seite 419 und 420:
KLEINERE MITTEILUNGEN 409 baumes sc
- Seite 421 und 422:
KLEINERE MITTEILUNGEN 411 Európa n
- Seite 423 und 424:
KLHINERf- MITTFÍILUNGEN 413 Die fo
- Seite 425 und 426:
KLEINKRK MlTTEILUN(ìr:N 415 den ü
- Seite 427 und 428:
KLEINERE MITTEILUN(iEN 417 figyelni
- Seite 429 und 430:
KLEINERE MITTEILUNGEN 419 daher nic
- Seite 431 und 432:
KISElîFÎ KOZI.hMKNVhK 421 hosszú
- Seite 433 und 434:
KIShF^B KOZI.FìMfiNYHK 423 Ö2. ti
- Seite 435 und 436:
KLEINERE MITTíJLUNOhN 423 hier im
- Seite 437 und 438:
KISFBB KO/l.hMKNVKK 427 63. Caprimu
- Seite 439 und 440:
KLEINERE MITTEILUNGEN 429 Az 1914.
- Seite 441 und 442:
KLF.INhRh MlTTKlLUNílEN 431 Limosa
- Seite 443 und 444:
KLKINHRR MlTThlLUNGEN 433 Accentor
- Seite 445 und 446:
KLEINERF: MITTEILUNGEN 435 szerint
- Seite 447 und 448:
KLEINERE MITTEILUNGEN 437 Fiilica a
- Seite 451:
ift^ M ii
- Seite 460:
"rSitSr^W'-fij;-! I' . UNH LiBRAR>


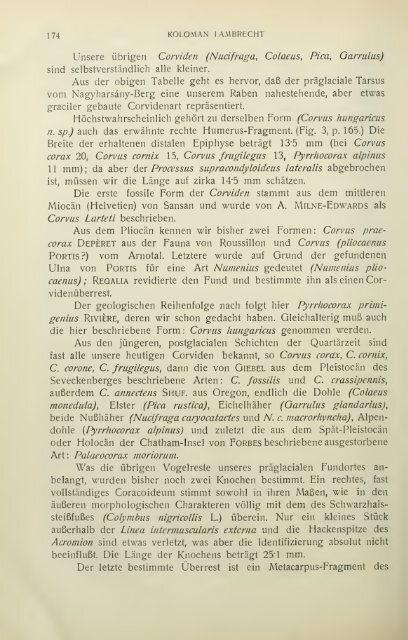
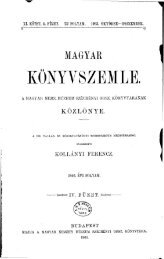



![Letöltés egy fájlban [36.8 MB - PDF] - EPA](https://img.yumpu.com/23369116/1/172x260/letoltes-egy-fajlban-368-mb-pdf-epa.jpg?quality=85)









