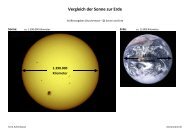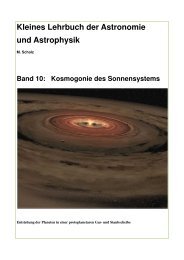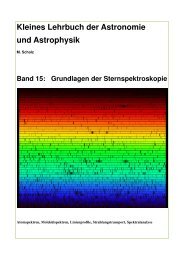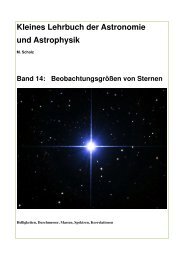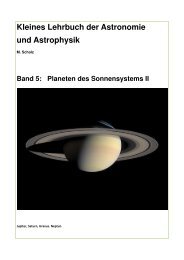Kleines Lehrbuch der Astronomie und Astrophysik - Astronomie.de
Kleines Lehrbuch der Astronomie und Astrophysik - Astronomie.de
Kleines Lehrbuch der Astronomie und Astrophysik - Astronomie.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
92<br />
Teleskope, Detektoren, Meßgeräte<br />
unterschei<strong>de</strong>n, gebaut <strong>und</strong> natürlich auch eingesetzt wer<strong>de</strong>n. Die Anfor<strong><strong>de</strong>r</strong>ungen an ein Sonnenteleskop<br />
sind aus diesen Grün<strong>de</strong>n z.T. völlig an<strong><strong>de</strong>r</strong>e als für Teleskope, die für <strong>de</strong>n Nachteinsatz konzipiert sind<br />
(selbstverständlich gibt es auch Sonnenteleskope, die nachts, z.B. für hochauflösen<strong>de</strong><br />
Sternspektroskopie, verwen<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n). Diese Aussage gilt natürlich auch für die eingesetzten<br />
Zusatzgeräte wie z.B. Filter, Spektrographen <strong>und</strong> CCD-Kameras.<br />
Die Möglichkeit, Beobachtungsgeräte mittels Forschungssatelliten auch außerhalb <strong><strong>de</strong>r</strong> Erdatmosphäre<br />
zu positionieren, hat in <strong>de</strong>n letzten Deka<strong>de</strong>n die solare <strong>Astrophysik</strong> wahrhaft revolutioniert. In dieser<br />
Hinsicht ist die 1995 gestartete Sonnenson<strong>de</strong> SOHO („Solar and Heliospheric Observatory“) ohne<br />
Frage eine einzige Erfolgsgeschichte. Mittlerweile sind bzw. waren mehrere Dutzend<br />
Forschungssatelliten fast ausschließlich mit <strong><strong>de</strong>r</strong> Beobachtung <strong><strong>de</strong>r</strong> Sonne beschäftigt. Zu nennen sind<br />
z.B. neben SOHO <strong><strong>de</strong>r</strong> japanische Satellit YOHKOH <strong>und</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> Röntgensatellit RHESSI, <strong><strong>de</strong>r</strong> u.a. zur<br />
Erforschung energiereicher solarer Flares eingesetzt wird. Seit <strong><strong>de</strong>r</strong> erfolgreichen Mission <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Sonnenson<strong>de</strong> „Ulysses“, die sie zweimal über die Sonnenpole führte, weiß man mehr über die<br />
räumliche Struktur <strong>de</strong>s Sonnenwin<strong>de</strong>s <strong>und</strong> über <strong>de</strong>n Aufbau <strong>de</strong>s globalen solaren Magnetfel<strong>de</strong>s.<br />
Dadurch, daß satellitengestützte Beobachtungsplattformen Beobachtungen in Frequenz-bereichen <strong>de</strong>s<br />
elektromagnetischem Spektrums erlauben, die von <strong><strong>de</strong>r</strong> Erdoberfläche aus aufgr<strong>und</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> selektiven<br />
Absorption <strong><strong>de</strong>r</strong> Erdatmosphäre unzugänglich sind (z.B. EUV, Röntgen- <strong>und</strong> Gammabereich), hat die<br />
Sonnenforschung in <strong>de</strong>n letzten Jahrzehnten von einer aufsehenerregen<strong>de</strong>n Ent<strong>de</strong>ckung zur an<strong><strong>de</strong>r</strong>en<br />
geführt.<br />
Nicht unerwähnt sollen auch die radioastronomischen Forschungseinrichtungen bleiben, <strong><strong>de</strong>r</strong>en<br />
Aufgabe es ist, die Sonne im Radiofrequenzbereich zu beobachten. Ihre Ergebnisse sind für ein<br />
<strong>de</strong>tailliertes Bild <strong><strong>de</strong>r</strong> Sonne genauso unverzichtbar wie die Beobachtungen im kurzwelligen <strong>und</strong><br />
optischen Bereich.<br />
Sonnenteleskope<br />
Zur Sonnenbeobachtung können im Prinzip alle Arten von optischen Teleskopen Verwendung fin<strong>de</strong>n.<br />
Da es dabei nicht so sehr um <strong><strong>de</strong>r</strong>en Lichtsammelvermögen ankommt, ist ihre Öffnung meistens kleiner<br />
als 1 Meter. Die Brennweite wählt man dagegen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Regel recht groß, um im Primärfokus ohne<br />
Einschaltung einer Zwischenoptik ein möglichst großes Sonnenbild zu erhalten. Dabei gilt als<br />
Faustregel, daß je<strong><strong>de</strong>r</strong> Meter Brennweite das Sonnenbild um ca. einen Zentimeter vergrößert. Um z.B.<br />
eine Auflösung von 1 Bogensek<strong>und</strong>e auf einem CCD-Detektor mit einer Pixelgröße von 30 µm zu<br />
erreichen, benötigt man eine Brennweite von ungefähr 10 Meter. Eine sehr lange Brennweite hat<br />
außer<strong>de</strong>m <strong>de</strong>n Vorteil, daß die vom Objektiv gesammelte Energie in <strong><strong>de</strong>r</strong> Fokalebene auf eine größere<br />
Fläche verteilt wird, was das Arbeiten im Primärfokus etwas weniger gefährlich macht (auch hier <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
obligatorische Hinweis: Schauen Sie niemals (!) durch ein Fernrohr zur Sonne, ohne daß die<br />
Lichtintensität durch geeignete Maßnahmen wie Objektivfilter auf ein ungefährliches Maß gedämpft<br />
wur<strong>de</strong>. Blin<strong>de</strong> Sonnenforscher können nur noch begrenzt zum Erkenntnisfortschritt beitragen).<br />
Sonnenteleskope haben mehr noch als gewöhnliche Teleskope mit Luftturbulenzen zu kämpfen,<br />
welche erfahrungsgemäß die Abbildungsqualität rapi<strong>de</strong> verschlechtern. Deshalb kommt sowohl <strong>de</strong>m<br />
Standort als auch <strong>de</strong>m technischen Design eines Sonnenobservatoriums eine große Be<strong>de</strong>utung zu. Als